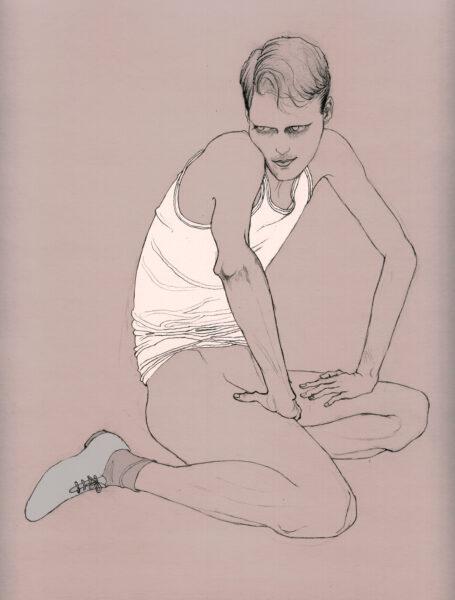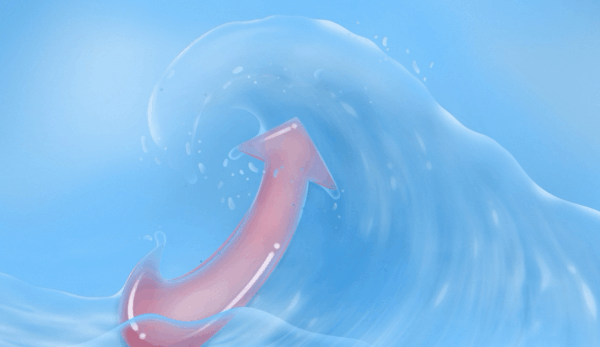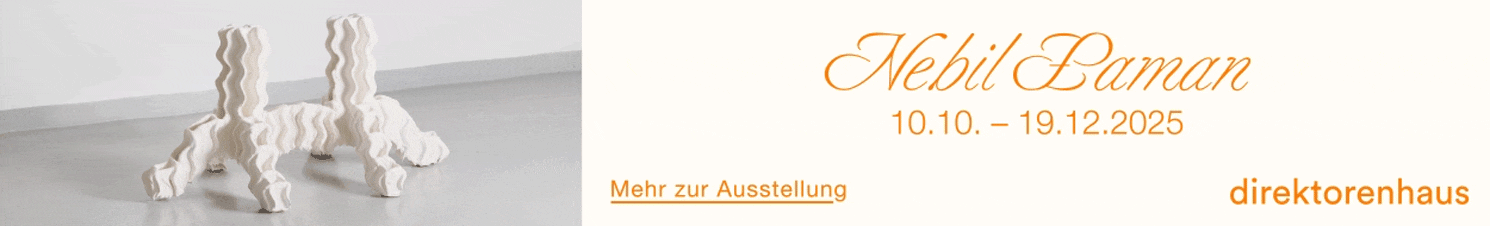1. Das Melodrama des Kunsthandwerks
Neue Mythen entstehen auf Schritt und Tritt. Ich hatte ja meine berufliche Seite in eine Richtung gelenkt, die darauf abzielt, den mentalen Graben, der zwischen Design und Kunst im letzten halben Jahrhundert (vor allem durch Institutionen) gezogen worden war, zu schließen. Prinzip Hängebrücke: Der Boden schwankt, aber man kommt rüber.
Es passiert schon hin und wieder, da stehe ich in Ausstellungsräumen und werde gefragt: Wie verdienen die Kunsthandwerker eigentlich Geld? Diese einfache Frage überrumpelt mich. Ich stottere wie ein ertappter Schüler. Denn die Antwort kann nur lauten: It’s complicated.
Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen oder sagen wir: künstlerisch schaffende Menschen, denen Materialität und die Art ihrer eigenen, noch nicht delegierten Produktion wichtig ist, haben keinen ausgeprägten Hang zum Geldverdienen. Sie haben sich in keiner starken Lobby organisiert, stehen der Beschäftigung mit Wirtschaftsfragen (Dax, Anlagevermögen, Spekulation) skeptisch gegenüber und selbst die Erfolgreichsten unter ihnen, vom Schlage eines Johannes Nagel oder Jojo Corväiá, verdienen einen Bruchteil dessen, was arrivierte „Künstler“ einfahren, z.B. Ai Weiwei, wenn dieser mit 650.000 Legosteinen das Seerosen-Gemälde von Claude Monet nachbildet, das dann im Londoner Design Museum gefeiert wird und mit internationalen Anzeigen und PR das Schwungrad des Kunstbetriebes aufrechterhält. Natürlich kennen wir alle vage den Grund für diese Situation. Seit sich im Westen der abstrakte Purismus zu einem Dogma entwickelte, es also fortan um die reine, vom Handwerk entschlackte Kunst gehen sollte, die auch die Architektur vom Ornament, die Musik von der Tonalität und die Kunst insgesamt von der Tradition befreite, ist auf dieser Suche nach dem Eindeutigen die Bedeutung von Kunst selbst abhandengekommen. Kunst produziert keine Schönheit mehr, sondern hauptsächlich Marktwerte. Die als zukunftsweisend empfundene Kunstmarktkunst bleibt voraussetzungslos konsumierbar und wird in Museen im Kreis wissender Menschen, gehirnlich geprägt von den Erfolgserfahrungen der spätkapitalistischen Spekulation, protektioniert.
Eine aktuelle Studie, die den hohen künstlerischen Stellenwert der Angewandten Künste und die enge Verzahnung von Kunst und Wissenschaft und Kunst und Handwerk untersucht, fehlt. Sie fehlt wirklich, denn Menschen glauben Studien und die Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst befindet sich in einem fortgeschrittenen Auflösungsprozess. Philipp Zitzlsperger (Das Design-Dilemma) hat unlängst für eine Annäherung von Design und Kunst unter neuen Vorzeichen plädiert, um ihren Akteuren in Zeiten von Marktkonformismus und Solutionismus eine andere Haltung zu ermöglichen, was ich voll und ganz befürworte. Die Frage ist aber: wie?
Zitzlsperger hält den öffentlich aufrechterhaltenen Gegensatz zwischen Design und Kunst für ein narratives Muster – eben eine Konstruktion, welche das Design als problemlösende, verschönernde und kommerzialisierte Nicht-Kunst festschreibt und hingegen die Kunst als autonome, widerständige und offene Praxis idealisiert. Kunst würde von jeder Dienstbarkeit freigesprochen. Problematisch sei dabei, dass diese Wertehierarchie von Design und Kunst heute als Normalität empfunden würde und vergessen wird, dass es schon einmal anders war. Das Kunsthandwerk, das unter einen Sammelbegriff wie Design fallen kann als Ausdruck einer Gestaltung und Formgebung, die auch Gewerbekunst, Gebrauchskunst oder Angewandte Kunst genannt wird, leidet an dieser Entwertung ganz konkret. Während etwa in der Kunst das geistige Eigentum noch siebzig Jahre nach dem Tod des Künstlers durch das Urheberrecht geschützt bleibt, sind es im Fall eines Design-Artefaktes maximal 25 Jahre. Die „eigenschöpfliche Leistung“ im Designgesetz (früher Geschmacksmusterschutz) ist der besondere künstlerischen Gestaltungshöhe im Urheberrecht nachgeordnet. Der Gesetzgeber, dessen Setzungen gesellschaftlich weitgehend anerkannt sind, unterscheidet also klar zwischen hoher und niedriger Kreativität, zwischen Malerei und Illustration, zwischen Skulptur und Vase.
2. Keramiker ./. gegen das Finanzamt Calau
Es gibt eine Institution, die hierzulande über noch mehr Autorität und Zugang zur Wahrheit verfügt als das Bundesverfassungsgericht, und das ist das Finanzamt. Nach zahllosen Versuchen, die ich über fünf Jahre unternommen habe, um politische Konstellationen zu verstehen und die ich zum überwiegenden Teil, muss ich gestehen, als äußerst unsystematisch bezeichnen muss – lieferte mir eine Sache, die nun folgt, den schlagenden Beweis für die Fehlkonstruktion des Design-Kunst-Systems. Es passierte im Verlauf einer dieser abendlichen Zusammenkünfte, derer es in Berlin eine zeitlang viele gab und bei denen man in hellen Räumen auf Kunst schaute, aber nicht kaufte. Ein Keramiker aus dem Brandenburger Umland verwickelte mich in ein Gespräch über seine Klage gegen das örtliche Finanzamt. Mit dem weiteren Zuhören (beide Wein) wurde die Geschichte immer spannender. Dieser talentierte Keramikmeister hatte darauf geklagt, nicht wie ein Keramiker besteuert zu werden, sondern wie ein Künstler.
Streitig war also gewesen, ob die Umsätze des Kunsthandwerkers – er fertigte im Reduktionsbrand geschwärzte Keramikschalen mit feinen, detailreichen Strukturen an – nach dem Regelsteuersatz von 19% zu besteuern seien oder nach dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2 UStG, also nur mit 7%. Die Urteilsbegründung liest sich wie eine Sternstunde der deutschen Rechtsprechung. Denn am Ende hatte der Richter dem Kunsthandwerker Recht gegeben, er wollte ihm den ermäßigten Steuersatz zusprechen, sah sich jedoch vor der Herausforderung, seine Begründung im dornenreichen Labyrinth des völlig veralteten und nicht mehr lebensnahen Gesetzeswerkes hindurchzulaborieren.
Mit Umsatzsteuerbescheiden hatte das Finanzamt die jeweiligen Umsatzsteuern für die Lieferungen des Keramikers unter Anwendung des Regelsteuersatzes von 19% festgelegt. Der Keramiker machte daraufhin Ansprüche geltend, seine Objekte ermäßigt zu besteuern, da sie ja wohl Einzelstücke seien und die Einordnung seiner Arbeiten als Kunstobjekte ihm wiederholt von Sachverständigen bestätigt worden sei. Außerdem habe er bei der Zeughausmesse einen Preis gewonnen. Das Finanzamt schlug zurück: Nein, no way, die Keramiken, so die Behörde, wären als Gegenstände der „angewandten Kunst“ zu verstehen, als Gebrauchsplastiken wie Brunnen, Kachelöfen, Türen, Türgriffe Fenster, Vasen und Lampen, kurzum: als Produkte. Der Gesetzgeber habe die Steuerermäßigung für Kunstgegenstände nicht auf Erzeugnisse des Kunsthandwerks ausgedehnt, sondern im Interesse einer eindeutigen Abgrenzung (sic!) der begünstigten Gegenstände ganz bewusst eingegrenzt. Für die umsatzsteuerliche Beurteilung maßgebend sei die Beschaffenheit des Gegenstandes und seine Einreihung in den Zolltarif. Ist der künstlerische Eindruck prägend und trete der Gebrauchswert zurück, argumentiert das Finanzamt, handele es sich um einen begünstigen Kunstgegenstand. Dagegen fielen künstlerische Erzeugnisse mit dem vorherrschenden Charakter von Gebrauchsgegenständen, deren Funktionalität durch eine künstlerische Gestaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werde, nicht unter die Position 97030000 des Zolltarifs. Und, so heißt es weiter: Erzeugnisse – auch wenn sie von einem Künstler handgefertigt seien – würden immer dann als nicht begünstigte Handelswaren gelten, wenn sie nach der äußeren Gestaltung vergleichbaren industriell oder handwerklich hergestellten Erzeugnissen ähnelten und mit diesen zumindest in einer potenziellen wirtschaftlichen Wettbewerbssituation stünden. Also, sagt das Finanzamt, unterlägen die Schalen des Keramikers dem allgemeinen Umsatzsteuersatz.
Der Richter zieht nun einen überraschenden Trumpf aus dem Hut: Vorliegend sei nämlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes maßgeblich, das mit Urteil vom 15.03.1985 bereits für die zollrechtliche Einordnung von Kunstgegenständen entschieden habe, dass der Begriff der Bildhauerei so auszulegen sei, dass er alle dreidimensionalen künstlerischen Produktionen umfasse, ungeachtet der angewandten Technik und des verwendeten Materials. Auch stellte der Gerichtshof fest, dass es außer Verhältnis wäre, die Besteuerung an das nahezu wertlose Material anzuknüpfen, dann aber den Wert des weitaus teureren Kunstgegenstandes als Basis heranzuziehen. Übertragen auf den Rechtsstreit stellt das Brandenburgische Gericht nun fest, dass die Keramiken erstens der weit auszulegenden Bildhauerei zugehörten als auch zweitens dreidimensionale künstlerische Produktionen seien. Somit stellten die vom Kläger geschaffenen Keramik-Einzelstücke Kunstgegenstände dar. Das Gericht entnahm diese Einschätzung dem Umstand, dass der Keramiker Ausstellungen verfolge (Internet-Links beweisen das). Er „fertigt keine Töpfe, die in Serie entstehen, seine Arbeiten sind Objekte von hoher Ausdruckskraft. Die Form ist bis ins kleinste Detail durchgearbeitet und der Oberfläche jede Zufälligkeit, wie sie für Töpferwaren charakteristisch ist, genommen“.
Im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Umstände – das sagen Juristen immer, wenn sie nicht weiter wissen – kommt es darauf an, ob im Einzelfall der individuelle Charakter eines Werkes aufgrund seiner seriellen Produktion verloren geht oder aber angesichts vorhandener individueller Unikats-Gestaltung der Charakter als Originalerzeugnis der Bildhauerkunst dominiert. Bei den vom Kläger in individuellen Schaffensprozessen erstellten Einzelstücken handelt es sich jedoch nicht um Reproduktionen von Objekten, so das Gericht, sondern um individuell hergestellte, sich nicht gleichende Erzeugnisse. Daher gibt das Gericht der Klage statt, der Kunsthandwerker kann mit 7 % besteuert werden.
3. Chamäleons, überall
Zufälligerweise kenne ich die Schalen des Keramikers sehr gut und, nun ja, sie ähneln sich schon, wenn ich ehrlich bin. Man hätte also auch völlig anders entscheiden können, aber man darf ja froh sein und feststellen: Hier geht es ums Prinzip.
Das Urteil zeigt alles:
1. die völlige Unkenntnis des Gerichts, was Kunst sein kann und was angewandte Kunst ist
2. willkürliche Grenzziehungen, die mal auf Material, mal auf Auflage abzielen
3. die mythische Überhöhung des Künstlerischen
4. die unklare Rolle des Wettbewerbs (Industrie? Töpferei?)
5. die Wichtigkeit von Referenzrahmen (Museen etc.)
Alles wird vermischt, eindeutige Zuordnungen werden sprachlich nur vorgegaukelt. Am Ende gelingt dem Richter mit dem Rückgriff auf den EuGH die Besserstellung des Kunsthandwerkers, jedoch nur, indem er ihn mit aller Macht des Wortes und technokratischer Fantasie zum freien Künstler im Sinne des Zolltarifs erklärt. Was zeigt uns dieser Fall?
Zunächst einmal demonstriert er sehr schön, dass Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker eigentlich in der Falle sitzen: Sie sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Gesetzgeber gesteht ihnen keine künstlerische Gestaltungskraft zu, die er aber jedem Kunststudenten zugestehen müsste, auch wenn dieser digitale Schnappschüsse in Serienauflage produziert. Gleichzeitig kann die angewandte Kunst aber nicht die Vorteile der freien Wirtschaft unbeschwert ausleben, wenn der Vergleichsmaßstab die Industrie ist. Anders gesagt: Fertigt der angewandte Künstler Tonschalen in kleiner Serie, die sich womöglich nur gering oder kaum unterscheiden (was eigentlich ein Gütekriterium für Serie ist), dann müssten sich diese mit industriell erzeugten Plastikschalen im Millionenauflage messen. Dass auf der einen Seite eine Person, auf der anderen ein Weltkonzern stehen mag und völlig ungleiche Finanzmittel, findet in dieser begriffsgesteuerten politischen Behandlung keine Berücksichtigung. Der Versuch, Eindeutigkeit in einer uneindeutigen Welt wenigstens dadurch herzustellen, indem man die Vielfalt der Welt möglichst präzise in Begriffskästchen einsortiert, ist eher dazu geeignet, Vielfalt zu verdrängen und Ungerechtigkeiten zu fördern. Hier wäre das hilfreich, was Thomas Bauer „Ambiguitätstraining“ nennt, also die Herausbildung einer differenzierten Gefühlskultur, bei der man lernt, sich auf Uneindeutigkeit und Vagheit von Phänomenen einzulassen.
Solange das Recht und die politische Praxis noch so undifferenziert, aber spaltend mit Künstlern, Designern und Kunsthandwerkern verfährt, fällt es schwer auf günstige Rahmenbedingungen zu hoffen. Allerdings: Mit diesem Urteil hat der Brandenburgische Keramikmeister einen interessanten Präzedenzfall geschaffen: Wenn sich nun hunderte Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker zu einer strategischen Steuerklage zusammenschlössen – als Mittel der politischen Veränderung – stünden die Aussichten für eine Rechtsfortbildung nicht schlecht, jedenfalls könnte eine wichtige Debatte entlang einer Rechtsentscheidung neu diskutiert werden.
4. Warum sich Künstler und Manufakturen verbünden müssen
Wie verdienen angewandte Künstler jetzt etwas mehr Geld? Der Markt ist begrenzt, Verkaufsplattformen überschaubar, Wissen und Kenntnis bei Kunden, die zu fundierten Qualitätsurteilen und vermehrtem Absatz von kunsthandwerklichen Objekten führen, selten.
Die Wege zum Geld sind rätselhaft. Aus meiner Sicht gibt es vier: nach wie vor den Galerieweg, bei dem angewandte Künstler über den klassischen Pfad des Kunstbetriebes zu ihren Käufern finden. Hier kann es sein, dass sich angewandte Künstlerinnen und Künstler nach außen hin als freie Künstler tarnen müssen, um die Debatte der Zugehörigkeit gar nicht erst aufkommen zu lassen. Da es allerdings mehr Künstler als Galerien gibt, bleibt das ein Weg durchs Nadelöhr.
Auch ohne Galerievertretung – so der häufigste anzutreffende Fall – kann man allein direkt in den Kundenkontakt treten; es gibt erfolgreiche Beispiele dafür wie etwa Jan Hoos, der seine Stuckarbeiten an Kunden wie Brad Pitt verkauft. Aber finanzielle Erfolgsgeschichten dieser Art sind rar und können oft nur auf der Basis einer konsequenten Spezialisierung entstehen. Ein weiterer Weg ist, intensiver mit Manufakturen zusammenzuarbeiten. Schon früher war die Kollaboration von bedeutenden Künstlern mit Manufakturen die Regel, Wilhelm Wagenfeld, Paloma Picasso, Henry van de Velde, Carl Fabergé, Gerhard Marcks haben bei Koch & Bergfeld Silber geprägt, Marguerite Friedlaender-Wildenhain hat bei KPM Spuren hinterlassen. Eine strategische und kreative Allianz zwischen Manufakturen und Künstlern könnte wirtschaftlich und qualitativ beide Seiten voranbringen. Schließlich gäbe es noch den konvivialistischen Weg: Kunsthandwerk könnte aus dem eindimensionalen ökonomischen Aufstiegsmodell des Kunstmarktes austreten, das von Infrastrukturen und Expertensystemen beeinflusst wird, die dem Kunsthandwerk nicht günstig sind. Auch in anderen Bereichen (z.B. dem Ökolandbau) werden neue Formen des Wirtschaftens erprobt, die den Kreislauf der permanenten Kreation von immer Mehr und unbegrenzten Bedürfnissen durchbrechen. Kunsthandwerk kann hier Alternativen bieten und wird in der Matrix „Non-Profit-Sektor, soziale und solidarische Ökonomie, Tauschringe“ etc. noch zu wenig gesehen. Das Kunsthandwerk stand immer den Reformbewegungen und Sozialutopien nahe, es fand z.B. in der deutschen Lebensreform (1890 – 1939) ebenso Eingang wie in die Shaker- und Arts & Craft-Bewegung im angelsächsischen Raum. Diese Tagträumerei wird vielleicht einmal wieder in Mode kommen, bei der das logische Urteilsvermögen zugunsten eines Gedankenschweifens ausgeschaltet wird und Energie für andere, langsamere Projekte freigibt. Slow ist immer gut, die Frage ist nur, wann sich das rechnet. Ein Start-Up-Inkubator für Neugründungen aus dem Kunsthandwerk ist mir bisher noch nie über den Weg gelaufen. Kunsthandwerk bleibt bis auf Weiteres, so wie die Poesie, eine Lebensform. Das ist die beste Voraussetzung für stürmische Zeiten.