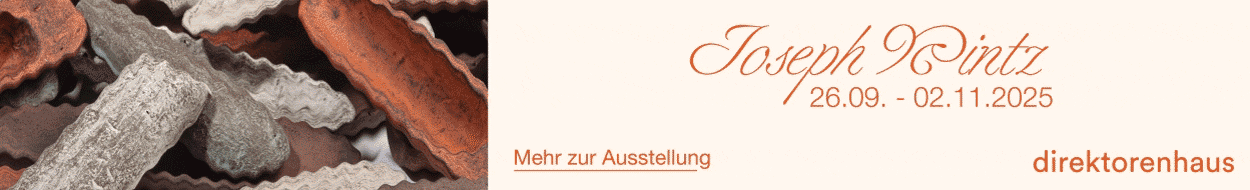Es gibt ein Video von Carla Hinrichs, der früheren Sprecherin der letzten Generation, nach der Erhebung der Anklage in München. Als Gründerin einer womöglich „kriminellen Vereinigung“ droht der Achtundzwanzigjährigen (und vier weiteren Mitgliedern) aktuell eine Haftstrafe. Und nicht mehr nur, wie früher einmal, zwei Monate auf Bewährung, sondern 2-3 Jahre Gefängnis. Das ist etwas anderes. Im besagten Video jedenfalls ringt die Aktivistin, auf einem Podium sitzend, sichtlich mitgenommen mit ihrer Situation. Es sei schon sehr unverständlich, erklärt sie, dass nun Luisa Neubauer, das Vorzeigegesicht der deutschen Klimabewegung, derzeit auf Buchtour gehe und sie voraussichtlich hinter Gitter.
Luisa Neubauer und Carla Hinrichs sind junge Frauen, beide 28 Jahre. Sie haben auch sonst einiges gemeinsam, z.B. den Kampf gegen die gesellschaftliche Passivität angesichts der Bedrohungen des Klimawandels. Carla Hinrichs Aussage bringt tatsächlich einiges auf den Punkt. Denn wo verläuft eigentlich die Grenze, die rote Linie zwischen den beiden jungen Aktivistinnen? Warum wird die eine von Politik, Gesellschaft und Verlagen hofiert und die andere beschimpft und aus dem Kreis der rechtschaffenden Bürgerschaft ausgestoßen?
Kriminell – was sonst?
Mehrere Kommentatoren, darunter solche, die kein wilder Gedanke je störte, kamen zu standgerichtlich schnellen Urteilen. Reinhard Müller sekundierte in der FAZ der Generalstaatsanwaltschaft München und nahm die ausstehenden Gerichtsurteile schon vorweg: Die Letzte Generation war kriminell, was sonst? Sie schlossen sich zusammen, um Straftaten zu begehen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Straftaten würden nicht dadurch gerechtfertigt, wenn sie Staatsziele auf dem Banner führten. Da könnte ja jeder kommen. Außerdem sprachen die Aktionen keineswegs einer Mehrheit aus dem Herzen. Jetzt müssen sie eben ihre Suppe auslöffeln.
Ja, die Mehrheit. Die Mehrheit läßt sich ungern im Autoverkehr stören, und hat auch gern mal auf die blockierenden Protestierer eingeprügelt, aber unter der Windschutzscheibe liegt Luisa Neubauers Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“. So mutig wie wir alle, die wir uns Hoffnung in der Krise wünschen? Bequeme Hoffnung ist schon längst ein kapitalistisches Projekt geworden, schreibt die Aktivistin aus der Sicherheit des Mainstreams heraus, bequeme Hoffnung möchte die Antwort auf die Klimakrise ausschließlich dort sehen, wo man selbst nicht gefragt ist, irgendetwas am eigenen Leben oder Verhalten zu verändern. Und so geht es weiter: Das Buch reiht Aussage an Aussagen, die so schön klingen und von jedem unterschrieben werden können wie „Ökologie darf nicht nur das moralisch richtige Leben propagieren, es muss das gute Leben werden“ und andere Leerformeln. Es wird gewarnt, es wird Hannah Arendt zitiert, und am Ende kniet Luisa Neubauer mit geöffneten Armen nieder. Die Sonnenstrahlen der Erkenntnis fallen ins Yogastudio Deutschland und sie schließt mit der Gewissheit, dass die Krise der Hoffnung Hoffnung an sich sei. Die Gesellschaft erhebt sich, bedächtig und ernst, nimmt die Yogatasche und vollführt einen kleinen Schritt hinaus aus der Komfortzone.
Vom alarmistischen Gerede zur Tat
Die Letzte Generation war anders. Ungeachtet der Frage, inwieweit die Maßnahmen und die Wahl der Mittel legal oder auch wirksam waren, muss man festhalten: sie redeten nicht nur, die Aktivisten der Letzten Generation, sie handelten. Diejenigen, die sich der Bewegung anschlossen, hatten nicht das Ziel, auf der sanften Welle der Mehrheitsmeinungen zu surfen, sie wollten gegen den Wind segeln und den Wind spüren, notfalls auch den harten Griff des wütenden Autofahrers oder Polizisten in Kauf nehmend.
Das Konzept der Selbstwirksamkeit, das 1977 von dem kanadischen Psychologen Albert Bandura eingeführt und seither in zahlreichen Einzelstudien weiterentwickelt wurde, prägt die Arbeit von Hartmut Rosa. Die Kernidee, so sieht es auch der Jenaer Soziologe, besteht darin, dass es für die menschliche Handlungs- und Lernfähigkeit entscheidend darauf ankommt, dass Subjekte sich zutrauen, Herausforderungen zu meistern, kontrolliert auf die Umwelt Einfluss nehmen und damit planvoll etwas bewirken zu können. Die kollektive Selbstwirksamkeit zeigt sich in Formen des gemeinsamen Handelns, so auch bei der letzten Generation, die zwar nicht nur aus jungen Leuten besteht, bei der jedoch eine markante Überrepräsentation der jüngeren Generation auszumachen war, insbesondere der 18 bis 25-Jährigen. Hier machten die jungen Leute nicht nur die Erfahrung sozialer Resonanzbeziehungen, in denen sie sich wechselseitig erreichen, antworten und verstärken, sondern sie erleben auch ihre Fähigkeit, etwas bewegen zu können, also weltwirksam zu sein.
Die Weltwirksamkeit der Letzten Generation nach außen erschöpfte sich vordergründig in der Störung des gesellschaftlichen Alltags. Die Taktik permanenter kleiner Nadelstiche an infrastrukturell sensiblen oder auch symbolträchtigen öffentlichen Orten spaltete die politische Öffentlichkeit. Das wussten auch die Aktivisten. Und sie waren sich natürlich immer dann, wenn sie aus der U-Bahn traten und die Westen überwarfen, um blitzplötzlich die Straße zu blockieren, im Klaren, was folgte: natürlich taten Polizei und Justiz, was sie in erwartbarer Weise tun mussten, sie lösten die Blockaden auf oder haschten nach denen, die gerade im Begriff waren, Kartoffelbrei oder Tomatensuppe auf Kunstwerke zu schütten.
So schlimm war es nun auch nicht
Die Studentenbewegung der 1960er Jahre war auch keine Spaßguerilla. Der Weg vom Agitieren, Protestieren und Demonstrieren, vom Spaßhaben und Spaßverderben bis zum Morden erfolgte nicht auf gerader Linie. Es gab kein einheitliches Muster für die Aktions- und Gewaltformen, allerdings bestanden sie überwiegend aus Demonstrationen, Störungen des Unibetriebes und auch Störungen des Verkehrs. Die meisten SDS-Protestler hatten Rauchkerzen, Farbbeutel, Pudding und Mehl im Gepäck, manche zündeten, wie in Belgien, ein Kaufhaus an. Andere Protesttechniken stammten von der Münchner Künstlergruppe SPUR (1959-1962) bzw. aus dem französischen Situationismus, der seinerseits Wurzeln im Dadaismus und Surrealismus besaß. Sie alle, berichtet der Historiker Rudolf Walter, agierten im Dreieck von subversivem Aktionsimus, politischen Surrealismus und schroffer Antipolitik. Aktivisten waren die Filmstars von Louis Malle. Und andere wurden zu Terroristen.
Auch die Bauernproteste liefen hier und da aus dem Ruder. Unfälle und Verletzungen waren bei den Traktor-Kolonnen an der Tagesordnung, es gab Fälle, bei denen Landwirte den Hitlergruß zeigten und einen Galgen schwangen, an dem symbolhaft die Regierung hing. Auch diese Proteste wurden von Vereinigungen organisiert, und sie streckten sich über einen Zeitraum von vier Monaten. Man muss sich also schon fragen, warum genau die Staatsanwaltschaften dieser Tage gerade die Aktivisten der Letzten Generation so hart ins Gebet nehmen und auf eine Stufe mit Drogenkartellen, der albanischen Mafia oder Wirecard stellen will.
Es dürfte Konsens darüber herrschen, dass die übergeordneten Ziele, der anerkennenswerte Zweck (Klimaschutz) die Letzte Generation nicht entlastet, wenn Straftaten verübt werden. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die Begehung von Strataten nicht das einzige Mittel zur Zielerreichung darstellte, die Aktivisten wandten sich auch zahlreichen legalen Protestformen zu. Dennoch, so der Professor Mark A. Zöllner von der Juristischen Fakultät der LMU, ist zuzugestehen, dass das öffentliche Erscheinungsbild der Gruppierung vor allem durch die zahlreichen Straßenblockaden mitgeprägt gewesen sein dürfte. Das Festkleben am Straßenbelag würde nach dem vorherrschenden vergeistigtem Gewaltbegriff jedenfalls die Tatbestandsvoraussetzungen der Nötigung (§ 240 I StGB) erfüllen. So gesehen ließe sich, so Zöllner, eine Ausrichtung der LG auf die Begehung von Straftaten grundsätzlich bejahen. Sie die Aktivisten aber nun eine kriminelle Vereinigung?
Hier komme, so der Münchener Strafrechtler, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ins Spiel. Eine Einstufung als kriminelle Vereinigung bewirke eine deutliche Vorverlagerung der Strafbarkeit, sodass keine Verdachtsmomente für konkret geplante Einzeltaten mehr dargelegt werden müssten. Zudem fungiere die Einstufung als Clan auch als „Türöffner“ für weitere grundrechtsintensive Ermittlungsmaßnahmen wie die Telekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung, von denen, muss man rückblickend feststellen, die Staatsanwaltschaft auch ausgiebig Gebrauch gemacht hat. Also: Der Vorwurf, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, wiegt schwer und sollte daher schon sehr genau hinterfragt werden.
Angegriffen hat die Letzte Generation am Ende das unbestimmte Schutzgut der öffentlichen Sicherheit, das typischerweise als „Zustand relativer Sicherheit aller Bürger von Gefahren für Leben, gesundheit und Sachgüter durch rechtswidrige Eingriffe“ beschrieben wird. Doch davon könne, so Zöllner, hier eigentlich keine Rede sein: die von den Aktivisten begangenen Taten waren Ausdruck eines ganz bewusst „gewaltfreien Widerstandes“. Die Blockaden oder Schmierereien im öffentlichen Raum waren zwar störend, schränkten aber keine Individualrechtsgüter der Bevölkerung ein. Dass Bürger nun etwa eine zeitlang im Stau stehen mussten oder ein Bau- oder Kunstwerk nicht mehr in seiner Ursprungsgetalt bewundert werden konnte, begründe keine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit.
Amnesty International und Green Legal Impact sehen das ähnlich und verurteilten die öffentliche Anklage der Letzten Generation. Mit der Anklage, konstatierte Paula Zimmermann, Expertin für Meinungs- und Versammlungsfreiheit bei Amnesty, erreiche die Kriminalisierung von Klimaprotest nun eine neue Eskalationsstufe. Der Paragraf 129 StGB diene eigentlich zur Bekämpfung organisierter Kriminalität; seine Anwendung auf gewaltfreien Protest, so Zimmermann, kriminalisiere zivilgesellschaftliches Engagement und schränke demokratische Spielräume ein.
Naiv oder vital?
Für den Berliner Protestforscher Dieter Rucht, der am WZB forscht, ist der fortgesetzte und disziplinierte Regelbruch im Geiste des zivilen Ungehorsams nichts grundlegend Schlechtes. Er sieht es als charakteristisch für Protestbewegungen an, dass sie vor allem in ihrer Frühphase auf breiten Widerstand stießen, aber im historischen Rückblick als notwendig und sinnvoll erkannt werden könnten. Allerdings läßt der Soziologe kein gutes Haar an der Letzten Generation: auch er hatte den Eindruck, hier wurde um des Protestes willen protestiert. Bei der Auswahl der Protestformen hätte die Letzte Generation darauf achten sollen, nicht nur auf den Reiz des Spektakels und der Heroisierung des „Widerstands“ ausgerichtet zu sein. Sie – die Aktivisten der Letzten Generation – hätte ja praktisch kaum Inhalte gehabt; sie hätten nur wenige konkrete und nicht unmittelbar zusammenhängende Forderungen erhoben, und wenn sie solche äußerten – wie zum Beispiel hinsichtlich der Gründung eiens „Gesellschaftsrates“, wären die Vorstellungen der Aktivisten „vollends naiv“ gewesen. Die letzte Generation, erklärt der Berliner Protestforscher (Jahrgang 1949), war auf Störung und Provokation ausgelegt und weniger auf den Austausch von Argumenten. Die Aktivisten hätten die Mühen der kontinuierlichen Überzeugungsarbeit annehmen und ihre gesellschaftliche Kritik in die gesellschaftlichen Verhältnisse einbetten müssen.
Wenn Jugendliche und junge Erwachsene sagen, dass ihr Lebensumfeld von älteren Erwachsenen, ja von „Alten“ bestimmt und geregelt wird, haben sie recht. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind die Außenseiter der modernen Gesellschaft. Das eigentliche Problem scheint dabei nicht die Ablehnung der Jugend durch die Alten zu sein, sondern eine weitgehende Indifferenz gegenüber jungen Menschen und ihren Bedürfnissen. Diese Alexithymie macht auch vor Protestforschern nicht halt, und die Probleme sind vorwiegend struktureller Art. Die junge Generation sieht sich einer alternen Gesellschaft gegenüber, die in eine demografische Schieflage geraten ist. Wenn im Laufe der nächsten 10 Jahre die größten Jahrgänge ins Rentenalter übergehen, gehen etwa 13 Millionen Erwerbstätige in den Ruhestand. Bei Wahlen sind nur 14% der Wahlberechtigten unter 30 Jahre alt. Ältere sind in allen politischen Institutionen überrepräsentiert. Die junge Generation ist superdivers, die Migrationshintergründe durchmischen sich kräftig. Kindheit und Jugend sind fragmentiert, politisch polarisiert, zugeschüttet mit Inhalten aus den sozialen Medien und aufgewachsen mit Multikrisen. Sie haben mit Masken in Schulen gesessen, ihre Kontakte beschränkt, erleben orientierungslose Erwachsene, gendernde Lehrer*innen und erstarkenden Rechtspopulismus. Zentrale Elemente des deutschen Selbstbildes, Ordnung und Verlässlichkeit, haben sie nie erlebt.
»Die Aktivisten verschieben keine Drogen, hinterziehen keine Steuern und sind nicht in Geldwäscheaktivitäten verwickelt.«
Wenn in jüngeren Menschen, gerade in ihren 20ern, politische Gefühle erwachen, orientieren auch sie sich an unterschiedlichen Vorbildern: das können Ideen des zivilen Ungehorsams (Henry David Thorau) ebenso sein wie die Anfeuerungen eines Andreas Malm, dem schwedischen Klimaaktivisten, der bei Matthes und Seitz erklärt, wie „man eine Pipeline in die Luft jagt.“ Denn das Einreißen von Zäunen könnte, so Malm, eines Tages durchaus als bloß geringfügiges, vielleicht sogar notwendiges Vergehen angesehen werden. Soweit hat es die Letzte Generation noch nicht einmal getrieben. Sie hat gesellschaftliches Engagement mit ihren Mitteln versucht.
Die Letzte Generation ist kein Clan. Die Aktivisten verschieben keine Drogen, hinterziehen keine Steuern und sind nicht in Geldwäscheaktivitäten verwickelt. Die Letzte Generation hat eigentlich alles richtig gemacht. Sie hat einen effizienten Protest auf die Straße gelegt und ihre Themen, Anliegen und Persönlichkeiten mit wenig Budget innerhalb kürzester Zeit in die breite Öffentlichkeit gezerrt. Das politische Establishment hat sie zum Feindbild erklärt, doch im Gegensatz zu vielen anderen, die mit dem doppelbödigen Marketing der Nachhaltigkeit und Enkeltauglichkeit verdienen, verfolgte die Letzte Generation keine wirtschaflichen Ziele und auch keine Gewalt. Die letzte Generation hat einem Gefühl der Ohnmacht Bilder gegeben.
Protest, schrieb der Autor Friedemann Karig vor einiger Zeit, sei kein Schönheitswettbewerb. Man nehme in Kauf, angefeindet zu werden. Störenfriede sind nicht beliebt und waren es nie. Manchmal, wenn der Zeitgeist es so will, will man sie auch lieber im Gefängnis sehen. Es könnte ja in Zukunft vielleicht noch, wer weiss, eine Straße blockiert werden.