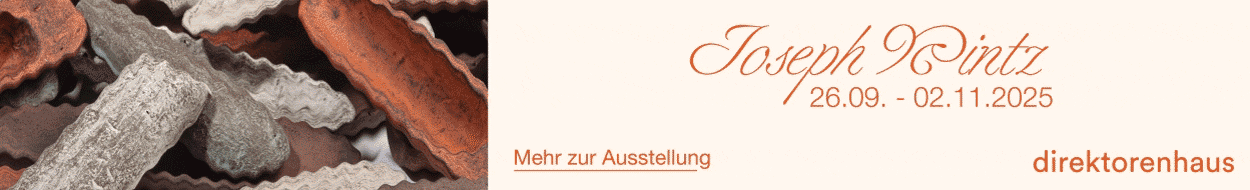Als ich neulich Helsing, die neue deutsche Rüstungshoffnung, im “Monocle”-Magazin entdeckte, musste ich mich erstmal strecken. Es war Mitternacht, als ich (ich stolperte gerade aus dem Chateau Royal auf die Neustädtische Kirchstraße) auf den Gedanken kam, vom Regierungsviertel zum Roten Rathaus zu schlendern, um zu schauen, ob die ukrainischen Flaggen noch hingen. Doch mein glasiger Blick blieb zunächst an einem Foto im Monocle hängen: Ein junger gut aussehender Helsing-Mann sitzt im Gefechtsunterstand konzentriert vor einem Laptop. Wahrscheinlich jagt er gerade eine HX-2, eine neue Strike-Drohne in den ukrainischen Luftraum gegen eine feindliche Maßnahme der Russen. Helsing, wissen Sie, verteidigt die Nato-Ostflanke mit seinem geplanten “Drohnenwall.” Helsing ist das Rüstungsunternehmen der Stunde, es ist jung, hipp, europäisch und sieht aus wie ein Start-up. Es ist auch eines: das erste und derzeit…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.