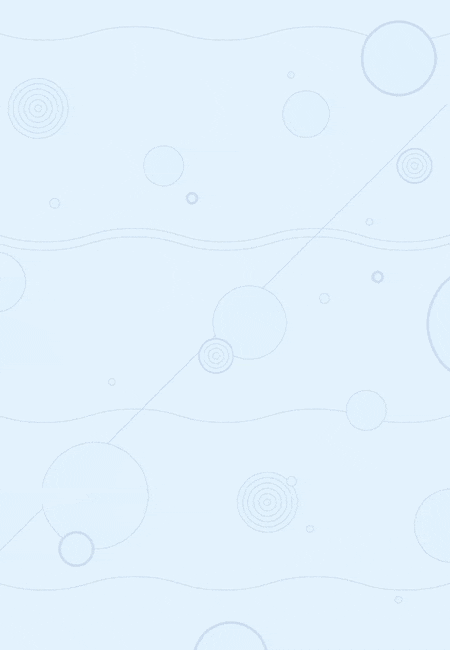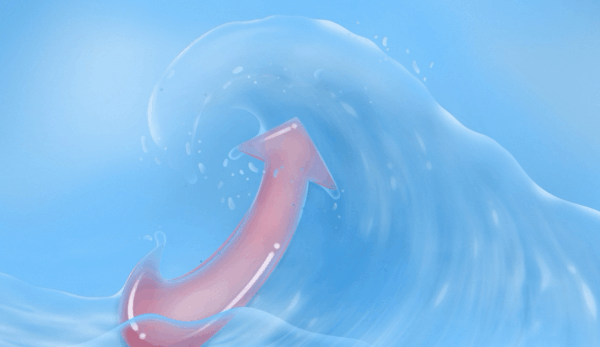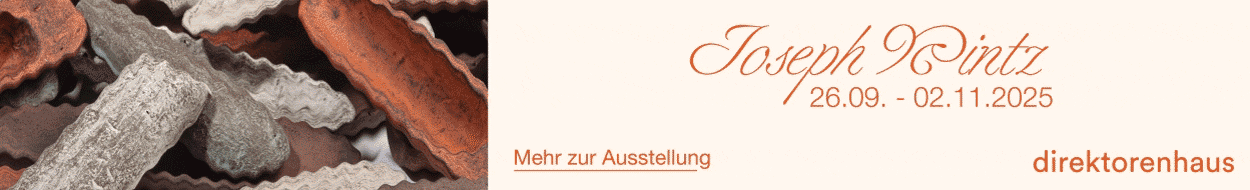Wir stehen noch unter der Herrschaft der Technikgläubigkeit. Unser gesunder Menschenverstand windet sich wie in einem Käfig, und wir sollten uns ab und zu an Zeiten zurückerinnern, in denen diese Tatsache für einen Moment in mathematischer Klarheit sichtbar wurde. Vielleicht sagt Ihnen, wenn Sie die Corona-Epidemie miterlebt haben, noch an die Luca-App etwas. Die Luca-App wurde von einem Berliner Start-up entwickelt und diente in aufwühlenden Pandemie-Zeiten als Beruhigungsmittel für die Bevölkerung. Ziel der App war die Kontaktpersonennachverfolgung, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu können. Die App kam in Restaurants und andere öffentlichen Gebäuden zum Einsatz, man checkte ein, wurde getrackt, checkte aus, die Daten wurden mit Gesundheitsämtern verknüpft, die wiederum auf diese Daten zugreifen konnten, um Gäste zu kontaktieren, die möglicherweise…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.