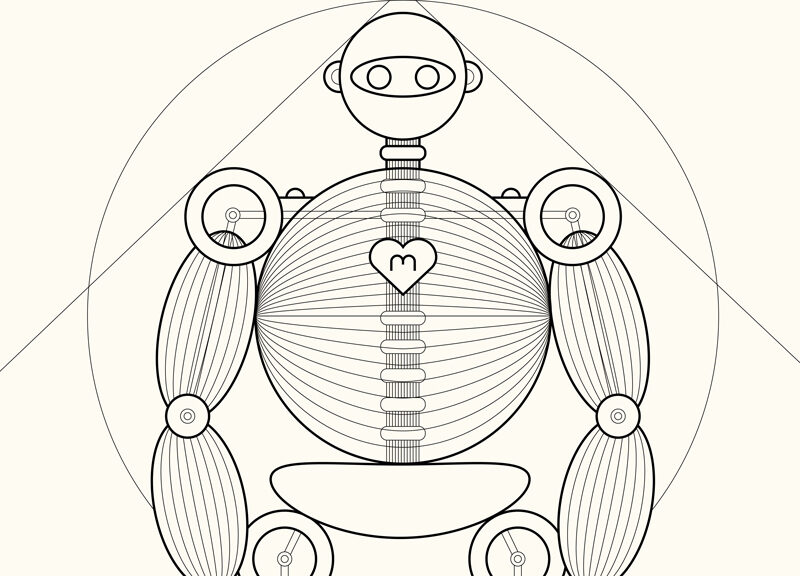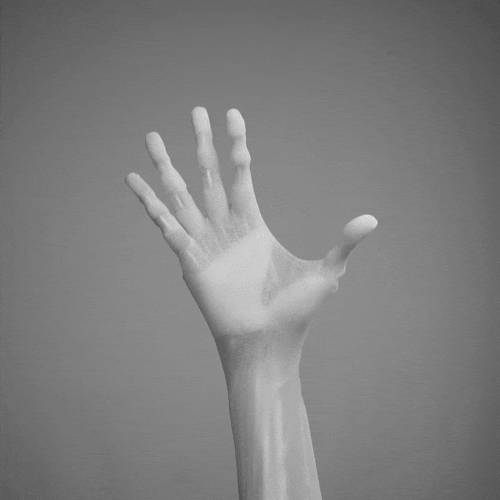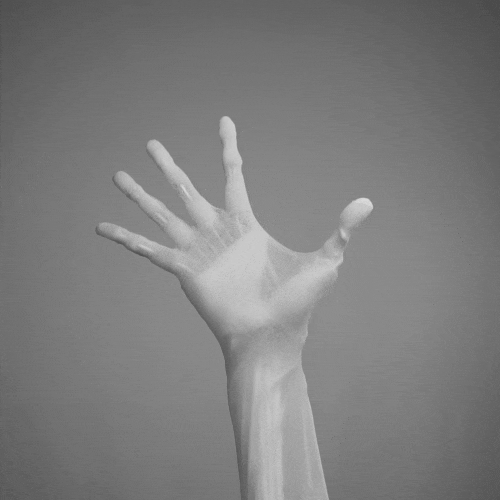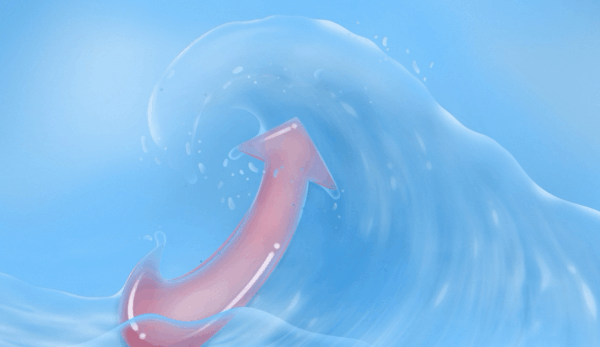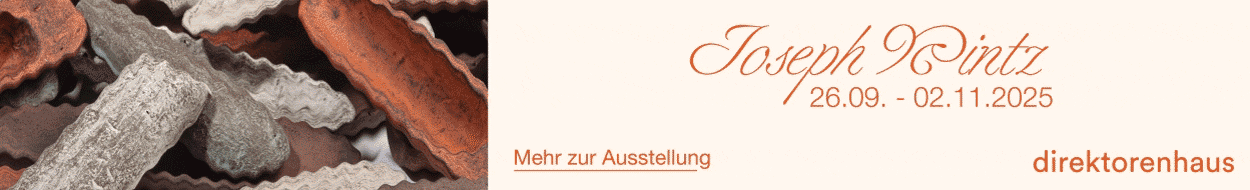Nein, ich werde nicht über Sex-Roboter schreiben. Die Zeit ist uns davongeeilt. Das feierliche Summen und Brummen der Kritiker der Künstlichen Intelligenz ist in die allgemeine Faszination, die den Möglichkeiten der KI entgegengebracht wird, eingebrandet; die Menschheit, sagte Slavoj Žižek, erschafft ihren eigenen Gott oder ihren eigenen Teufel. Es gibt allen Grund zur Sorge, dass techno-gnostische Visionen einer postmenschlichen Welt ideologische Fantasien sind, die den Abgrund, der uns erwartet, verwischen. Der slowenische Philosoph hat sich dann einfach selbst zum KI-Projekt umformatiert: Auf der Website infiniteconversation.com konnte man eine nicht enden wollende Diskussion zwischen Werner Herzog und Žižek hören. Sie ist das laufend fortgeschriebene Produkt einer künstlichen Intelligenz, die beide nachahmte. Der Urheber Giacomo Miceli wollte mit seinem Projekt das Bewusstsein dafür schärfen, wie einfach mittlerweile eine echte Stimme synthetisch zu erzeugen sei. In den Augen von Žižek taugt das generierte Gespräch zwischen Herzog und ihm nicht als Anlass für eine tiefgründige Analyse der Gefahren solcher KI-Produkte. Es kann lediglich als Hintergrund-Klangteppich beim Autofahren dienen, wie Muzak (aufgezeichnete leichte Hintergrundmusik, die an öffentlichen Plätzen über Lautsprecher abgespielt wird) – man hört nicht wirklich hin, sondern genießt nur passiv den Klang (wenn man kann).
Die Integration von AGI (Artificial General Intelligence = starker KI) mit Robotik schlägt ein neues Kapitel auf: die Sinnestäuschung verläuft nicht mehr nur auf der zwei- oder dreidimensionalen Bildebene, sondern schiebt sich in den realen, psychischen Raum vor. Wenn Sie sich einen Roboter wünschen, der wie die italienische Ministerpräsidentin aussieht, bekommen Sie den bald. Kennen Sie das Video, in dem Giorgia Meloni Elon Musk küsst? Es war natürlich KI-generiert.
Man darf Robotik und KI nicht verwechseln. Robotik ist ein Aspekt der Informatik und Technik, bei dem Maschinen gebaut und programmiert werden, um Aufgaben ohne menschliche Einmischung auszuführen. KI umfasst wiederum Systeme, die den menschlichen Geist nachahmen, um zu lernen, Probleme zu lösen und Entscheidungen unabhängig zu treffen, ohne die bereits programmierten Anweisungen zu benötigen.
Die Robotik gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Dennoch begannen Ingenieure erst Mitte des 20. Jahrhunderts, Maschinen zu entwickeln, die aussahen und sich wie Menschen verhielten und sich in einer kontrollierten Umgebung bewegen konnten. Heutzutage findet man Robotik in vielen Branchen, darunter Fertigung, Gesundheitswesen, Weltraumforschung und autonome Fahrzeuge. Für KI ist ein Grundwissen über KI-Technologien unerlässlich, um zu verstehen, wie Computer mit verschiedenen maschinellen Lerntechniken wie Netzwerken, Fuzzy-Logik und Deep Learning für intelligentes Verhalten programmiert werden.
Maschinen können bereits die Aufgabe von Künstlern erledigen und sie werden wahrscheinlich klüger werden als die Klügsten von uns. Da wird es bald möglich sein, dass eine KI auch Philosophen ersetzen kann. Die Entwickler dieser Zukunft sind die Metaphysiker der neuen natürlichen Unordnung.
Man sollte aber auch nicht die Materienwogen der Robotik vergessen. Gegenwärtig, und auch hier dürfte das Jahr 2025 eine Wegscheide markieren, erfolgen in der Entwicklung biomimetischer und intelligenter bionischer Roboter Innovationssprünge in unterschiedlicher Gangart. Clone Robotocs zum Beispiel hat einen humanoiden Roboter-Torso entwickelt, der sich mit künstlichen Muskeln und Knochen fast lebensecht bewegen kann. Das polnische Start-up hebt das Level der Lebensechtheit noch einmal eine Latte höher: Die Grundstruktur der Humanoiden besteht aus einer festen Wirbelsäule, die an einem menschenähnlichen Becken befestigt ist. Massive Rippen sind an der Wirbelsäule befestigt. Der Roboter hat einen Kopf, Kopf und Schultern sind mit einer weißen, gummiartigen Haut bedeckt. Der Roboter hat auch zwei menschenähnliche Arme mit entsprechenden Händen. Die künstlichen Muskeln des Roboters werden von einem System von batteriebetriebenen Pumpen und Ventilen angetrieben. Die Pumpen bewegen Wasser aus einem flexiblen Behälter durch den Oberkörper über Schläuche. Dabei erzeugen sie den nötigen Druck, um die künstlichen Muskeln zu beugen und die zugehörigen Sehnen zu dehnen. Dadurch können natürlich aussehende Bewegungen von Kopf, Armen und Händen realisiert werden.
Die Hand – die Clone Hand – ist nach Aussagen der beiden Gründer die weltweit beste Roboterhand, die der menschlichen muskuloskelettalen Struktur am nächsten kommt. Sie wird von proprietären hydraulischen Muskeln und Ventilen angetrieben. Seine Größe und biologischen Merkmale sind die gleichen wie die einer menschlichen Hand, einschließlich eines halben Armknochens, eines vollständigen Unterarms und einer Handfläche sowie aller möglichen Freiheitsgrade. Sein Design und seine Funktionen wurden entwickelt, um die Geschicklichkeit und Manipulationsfähigkeiten menschlicher Hände zu simulieren, und es ist in der Lage, eine Vielzahl komplexer Manipulationsaufgaben auszuführen. Als Material verwendet das polnische Unternehmen eigens entwickelte Polymermaterialien, die weicher, leichter, billiger und besser sind als herkömmliche Metalle. Kurz: Das biomimentische Design macht hier den Unterschied. Die Zeiten, in denen Roboter wie C-3PO durch die galaktischen Landschaften holperten, sind vorbei.
Wenn Super-KI und feine, ausdifferenzierte Robotik zusammentreffen, sind wir endgültig im Reich der Realität gewordenen Science Fiction angekommen. Die Aussicht, dass intelligente Roboter nur in der industriellen Automatisierung eingesetzt werden, in der medizinischen Hilfe oder in der Dienstleistungsbranche, verkürzt den Blick. Der Geist zwingt sich zum Durchgang durch die Labyrinthe und die fasrigen Windungen der Materie, und je echter Münder, das Heben von Augenbrauen, Bewegungen der Hand und ein verführerischer Augenaufschlag nachgeamt werden, desto mehr schmiltz auch das Bewusstsein, mit einem digitalen Assistenten (oder einer digitalen Assistentin) unterwegs zu sein. Geist und Körper verschmelzen wie Figuren eines balinesischen Theaters.
Die Entwicklungen, die wir bis 2030 zu erwarten haben, sind nicht nur heimlichen sexuellen Begegnungen vorbehalten. Für die Verdrängung von Wissensarbeitern hat die Materialisierung des Geistes wenig Auswirkungen. Massive Vertreibung von Wissensarbeitern, beginnend mit Programmierern, Datenanalysten und Inhaltserstellern, was zu strukturellen Arbeitslosenquoten von über 20 % in den entwickelten Volkswirtschaften Dies könnte durch das Aufkommen neuer Rollen in der Verwaltung von AGI-Systemen und Robotern gemildert werden, aber die Übergangszeit wird wahrscheinlich stark störend sein. Auch in der Fertigung wären lebensechte humanoide Roboter eher ein wirtschaftlicher Faktor, der großflächige Einsatz von AGI-betriebenen humanoiden Robotern wird bis 2030 mehr als 500.000 Einheiten erreichen und die Produktion und Logistik verändern. Der anfängliche Einsatz in kontrollierten Umgebungen wie Autofabriken wird sich auf allgemeinere Umgebungen ausweiten, was möglicherweise zu einem exponentiellen Wachstum führt, wenn Roboter mehr Roboter bauen.
Die Armeen werden aus Robotern bestehen. AGI-Systeme und fortschrittliche Roboter werden in fast alle militärischen Kommando- und Kontrollsysteme integriert, wodurch eine neue Dynamik des Wettrüstens entsteht. Diese Integration könnte entweder die strategische Stabilität durch bessere Entscheidungsfindung verbessern oder das Risiko einer schnellen Eskalation erhöhen. Geheimdienste werden durch AGI-Analysefunktionen und Roboterüberwachungssysteme aller Art transformiert. Dies könnte entweder die strategische Stabilität durch bessere Intelligenz verbessern oder neue Schwachstellen schaffen, wenn die Systeme kompromittiert werden. AGI-fähige automatisierte Cyberabwehrsysteme und Roboter-Sicherheitskräfte werden für kritische Infrastrukturen obligatorisch. Diese Systeme können entweder die Sicherheit verbessern oder durch ihre Vernetzung und Komplexität neue Schwachstellen schaffen. Am Ende bilden sich „AGI-Roboter-Blöcke“ – strategische Allianzen rund um gemeinsame Entwicklungs- und Governance-Ansätze sowohl für AGI als auch für fortgeschrittene Robotik.
Wie dem im Einzelnen auch sei, Robotik wird uns umgeben, und vielleicht entstehen auch „AGI-freie“ und „roboterfreie“ Zonen in Städten und öffentlichen Räumen, die Sicherheitsüberlegungen und soziale Bedenken hinsichtlich der technologischen Präsenz widerspiegeln. Alles das beschreibt aber nicht die psychologischen eund emotionalen Veränderungen, die lebensechte Roboter mitsichbringen. Menschen neigen dazu, ihre menschlichen Eigenschaften auf Nichtmenschliches zu übertragen. Diese „Vermenschlichung“ nennt man fachsprachlich Anthropomorphismus. Das kann man sehr leicht bei der Vermenschlichung von Tieren beobachten.
So existiert seit kurzem die Disziplin der Roboterpsychologie. Das LIT Robopsychology Lab an der Universität Linz etwa erforscht, wie sich das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflussfaktoren auf das individuelle Erleben intelligenter Maschinen und der Interaktion mit solchen auswirkt. Ob es die Kollaboration mit Robotern ist, die Menschenähnlichkeit bei Maschionen oder die Wirkung synthetischer Stimmen oder die Wirkung neuer Körperaugmentierungs-Tools (Implantate, Exoskelette, etc.) auf Menschen ist – der Forschungsbedarf ist gerade so gut wie explodiert.
Die Roboterpsychologie ist ein wachsendes Forschungsfeld, das sich mit der Interaktion zwischen Menschen und Robotern beschäftigt. Sie untersucht, wie wir auf künstliche Intelligenz (KI) und autonome Maschinen reagieren, wie sie unser Verhalten beeinflussen und welche psychologischen Herausforderungen sich daraus ergeben.
Die Fähigkeit von Robotern, Emotionen zu simulieren, kann tiefgreifende Auswirkungen auf soziale Beziehungen haben. In Bereichen wie Pflege, Bildung und Kundenservice werden empathische Roboter bereits eingesetzt, um den Menschen zu unterstützen. Es gibt jedoch auch Bedenken, dass Menschen eine zu starke emotionale Bindung zu Robotern entwickeln und dadurch soziale Isolation gefördert werden könnte. Hochentwickelte humanoide Roboter könnten Menschen täuschen, indem sie vorgeben, echte Emotionen zu haben. Dies könnte ethische Fragen aufwerfen, insbesondere wenn Menschen nicht mehr zwischen Mensch und Maschine unterscheiden können. Die bewusste Gestaltung von Robotern, um Täuschung zu vermeiden, ist daher ein wichtiges Thema in der Roboterpsychologie.
Die Psychologin Martin Mara an der erwähnten Johannes Kepler Universität in Linz geht grundsätzlich techno-optimistisch an die Sache heran. Ich glaube, sagte sie, dass die Herausforderung darin bestehe es zu schaffen, die menschliche Entscheidungs- und Handlungsautonomie zu gewährleisten. Wenn etwa die KI bei einer Ärztin auf Basis der Analyse von Röntgenbildern eine Diagnose nahelegt oder eine bestimmte Kandidatin für das Vorstellungsgespräch vorschlägt, sollten Menschen diesen Vorschlägen nicht blind folgen. Sie sollten die Möglichkeit haben, sich auf Basis von menschlichem Erfahrungswissen anders zu entscheiden. Ein Weg dorthin, so Martina Mara, sei die sogenannte „Explainable AI“, also künstliche Intelligenz, die erklärt und darüber informiert, wie und warum sie zu dem Ergebnis kommt und welche Faktoren zu einem bestimmten Output beigetragen haben.
Ob das mal nicht zu zweckoptimistisch gedacht ist. Denn die prinzipielle Frage ist, zu einer Notation und Chiffrierung dessen zu gelangen, was nicht mit Worten oder rationalen Entscheidungen zu beschreiben ist: Liebe, Zuneigung, Trieb, Verführung, Desorientierung, Desinformation, Wirkungen der Schmeichelei. Wenn Spitzfindigkeiten einer austrainierten Künstlichen Intelligenz auf fast perfekte Mimik, Gestik und Körper der neuen Roboter treffen, sind wir unseren dramatischen und psychologischen Situationen ausgeliefert. Wer jemals in einem Gerichtssaal gesessen hat, der weiss, dass Entscheidungen – so sachlich und klug sie vorbereitet gewesen sein mögen – nicht allein auf der Basis von Fakten fallen. Die Verwirrung der Gefühle ist real und menschlich. Wer weiss, vielleicht hat Giorgia Meloni, die ja unter dem Pseudonym Josie Bell über 140 Liebesromane verfasst hat, ja doch Elon Musk geküsst.