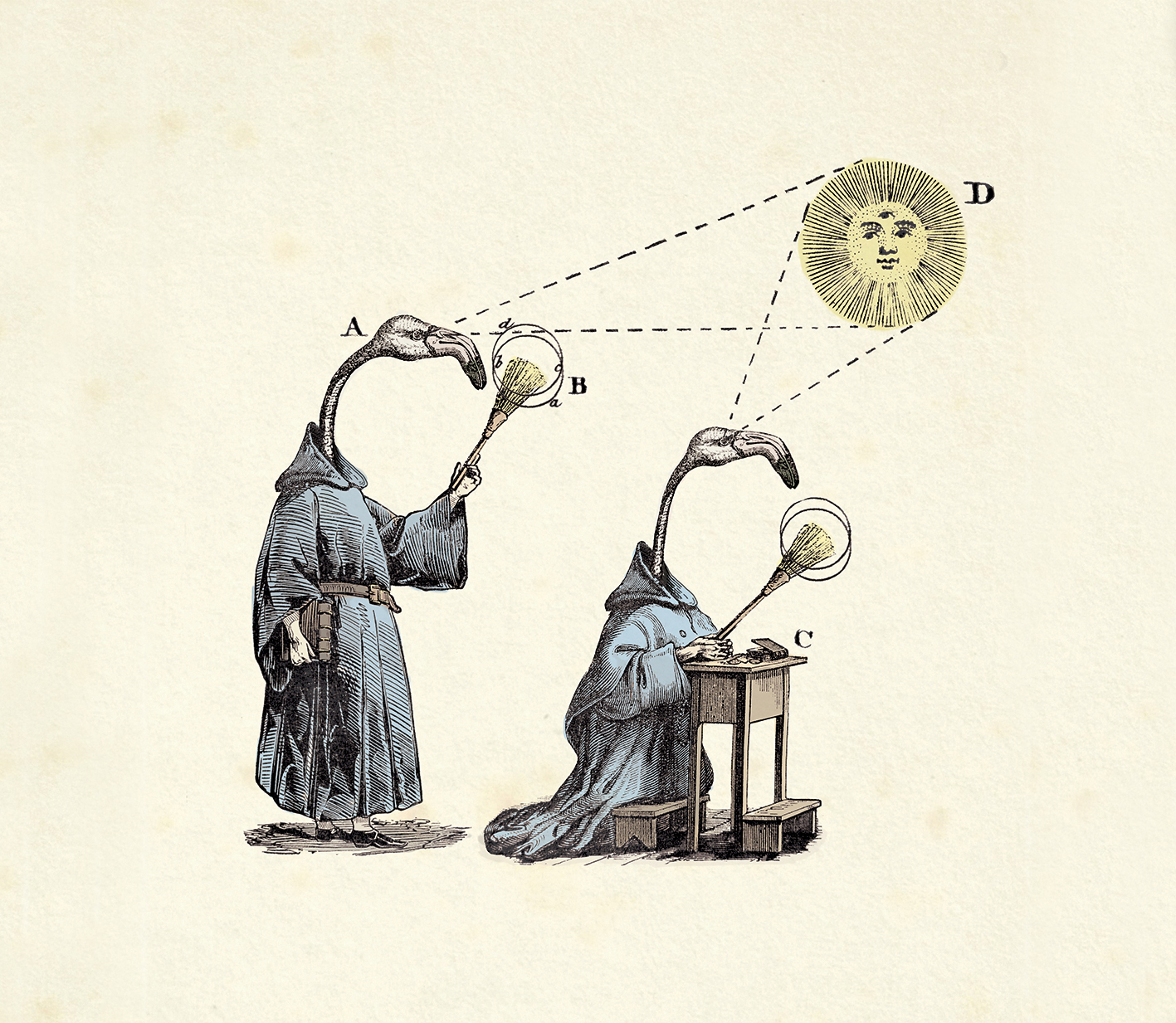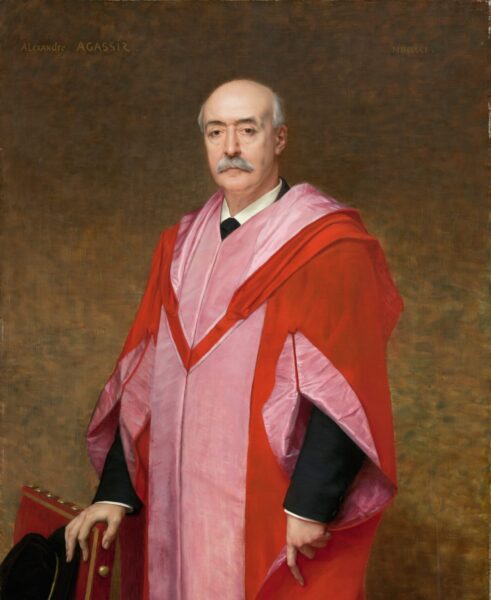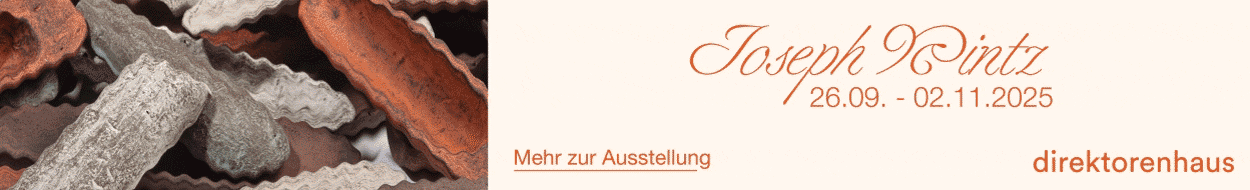Als im Juli 2024 eine Kugel nur minimal knapp am Ohr von Donald Trump vorbeizischte, so knapp, wie es eigentlich nur geht, nach acht Schüssen, wovon Trump eine zwei Zentimeter große Wunde an der rechten Ohrmuschel davontrug, bevor der angeschossene Präsidentschaftskandidat in Sekundenschnelle den Arm emporriss und seine legendäre Pose einnahm – als an diesem Tag all das passierte, was in ein Campaigning-Drehbuch passte, entwickelten so manche ihre Theorien. Wie war nicht alles eigenartig. Es konnte doch nicht sein, dass ein 20-jähriger Mann einfach so in die Nähe von Trump kommt, um ihn zu erschießen. War es nicht auch sonderbar, dass der Secret Service, der Trump beschützen sollte, das nicht auf die Reihe bekam, Trump aber sofort nach dem Anschuss in der Lage war, mit erhobener Faust zu posieren und…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.