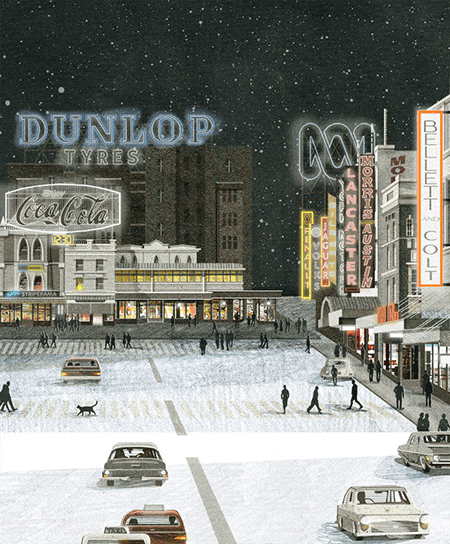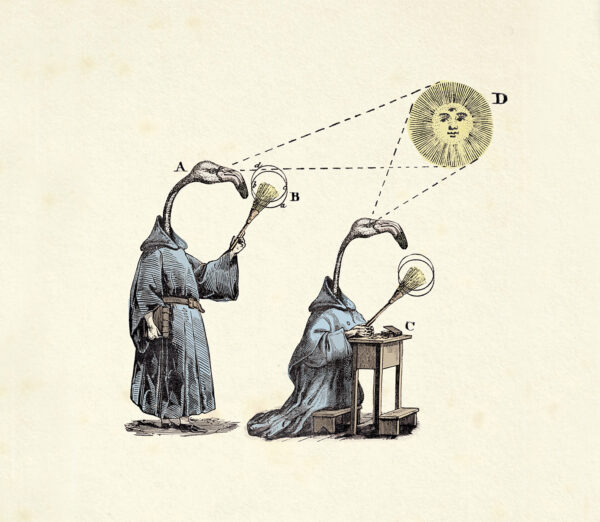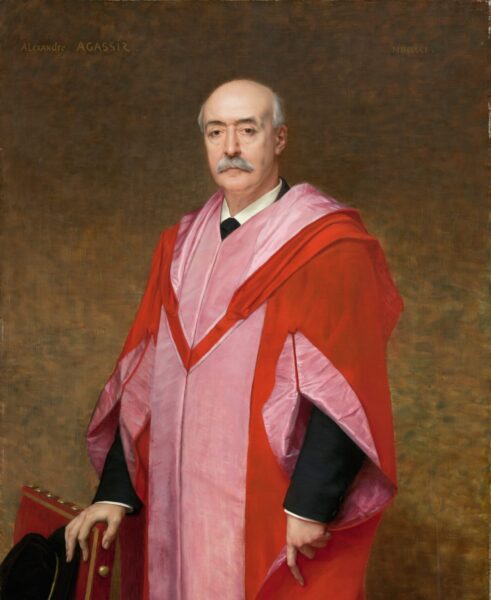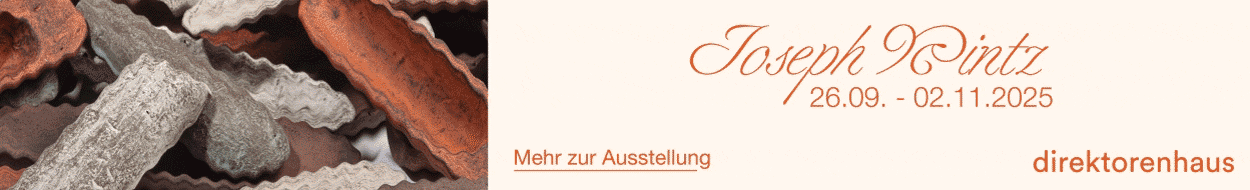Es kommt vor, da sitze ich in irgendeiner Ecke des Universums, z.B. in einer abgewetzten Hotelbar in Perth, und denke daran, wie es wäre, jetzt in Europa zu leben. Die Europäer erleben, so prognostizierte es Sönke Neitzel neulich, den letzten Sommer in Frieden. Für den Potsdamer Historiker ist ein Angriff aus Moskau in diesem Herbst im Bereich des Denkbaren. Das Narwa-Szenario. Nicht Warschau wird überrannt, und auch nicht der Cortado im Prenzlauer Berg wackelt aufgrund von Bombeneinschlägen in den recyclebaren Bechern – aber Putin wird eben das geografische Vorfeld politisch, ökonomisch und militärisch dominieren wollen, und das träfe allen voran das Baltikum.
Im Kern beschäftigt sich das Gedankenspiel, das unlängst der Politikwissenschaftler Carlo Masala in die Diskussion gebracht hat, mit der Gefahr an einem der östlichsten Zipfel der Nato: Nämlich der Stadt Narwa in Estland, die direkt an der Grenze zu Russland liegt. Russische Truppen besetzen in diesem Gedankenspiel Narwa. Ziel von Moskau ist es, die Nato zu einer Reaktion gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags zu provozieren. Dieser sieht vor, dass für die Nato ein Angriff auf eines ihrer Mitgliedsländer einem Angriff auf alle Bündnispartner gleichkommt.
Die Mitglieder sind verpflichtet, dem angegriffenen Land Beistand zu leisten, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt. In dem Szenario von Masala, das er für das Jahr 2028 durchspielt, stehen die NATO-Staaten nun vor einem Dilemma. Reagieren sie und riskieren damit eine Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg? Oder tun sie nichts und machen damit ihre Glaubwürdigkeit zunichte, begraben das Sicherheitsversprechen der Nato und machen Putin weiter Mut? Würde ich für Narwa sterben wollen?
Diese Frage beschäftigte mich schon einmal vor drei Jahrzehnten, im Wehrdienst. Damals gab es den noch, und es waren 12 Monate, in denen man in den gerade übernommenen NVA-Barracken seine Karriere vom willenlosen Grundwehrdienstleistenden in den Status des Entlassungskandidaten entwickeln konnte, eine finale Phase, die die meisten letztlich im alkoholisierten Dauerzustand verbrachten. Ich als Vertrauensperson der Mannschaften, einer Art Klassensprecher, tat mich durch besonders hartnäckig vorgetragene Kritik an der Verpflegung der Rekruten hervor; die Kantine hatte eine Woche lang hintereinander nur Grützwurst serviert. Die ganze DDR auf einem Teller. Die Verpflegung wurde arbeitsteilig von einem Ehepaar besorgt, wobei der Ehemann die Kantine, die Frau das privat geführte Casino mit kleinem Imbiss am Eingang zur Kaserne leitete. Pest oder Cholera? Wir landeten alle im Casino und aßen eine Woche lang Bockwurst. Natürlich war das ein hinterrücks abgekarteter Deal, das Casino machte mehr Umsatz, die Warenbestellung der Kantine lief über öffentliche Gelder. Wie dem auch war – ich kritisierte diesen Zustand in Vertretung meiner Kameraden auf das Schärfste und der Oberstleutnant entledigte sich meiner auf diplomatische Art: er beorderte mich an die „Cocktail-Front“ nach Brüssel. Zum Nato-Hauptquartier.
Hier wurde ich nun wieder Mensch. Als die schöne, frische Mannschaft meiner damaligen Bundeswehrkollegen (man sagte Kameraden) für Abende in die Rue Jacques de Lalaing in Brüssel zog, zu diesen Nato-Empfängen in der Deutschen Botschaft, bei denen der Sekt in Strömen floß und sich im tiefen Frieden der Nachwendezeit über unsere mausgrauen Dienstanzüge ergoß, bevor sich der adrette General, bei dem ich wohnte, von seiner Frau endgültig trennte und ich auf dem Flohmarkt am Place du Jeu de Balle einige alte Ausgaben des „Le Petit Parisien“ erstand – kaufte ich auch (und darauf wollte ich hinaus) einen Siebdruck von Käthe Kollwitz. Es war das bekannteste deutsche Anti-Kriegsplakat. Ein junger Mann erhebt mit leidenschaftlicher Gebärde die Hand zum Schwur, sein Arm ist, die ganze Bildhöhe ausfüllend, emporgereckt; die linke Hand hat er zur Bekräftigung des Eids auf sein Herz gelegt und sein Mund ist aufgerissen zu dem Ruf: »Nie wieder Krieg!« Eindringlich hat dieser beschwörende Appell, durch den Käthe Kollwitz den Betrachter zur Identifikation auffordert, in dem Jungen Gestalt angenommen. Dieser steht gegen einen scharfen Wind gewandt, die Haare wehen, sein Gesichtsausdruck verrät äußerste Anspannung. Die Darstellung wird – graphisch ideal gelöst – durch die schwungvolle Handschrift der Kollwitz ergänzt. Der das Bild beherrschende, hochgereckte Arm überschneidet teilweise das von der Kollwitz zweimal kräftig unterstrichene Wort ›Krieg‹ und dient so gleichzeitig als Ausrufezeichen. Der Siebdruck zeigte all das in relativ unbeschadeter Form, ich rollte das Plakat ein, nahm es mit nach Hause, wo es ungefähr 20 Jahre an meiner Wand oberhalb der Ikea-Küchenzeile hing. „Nie wieder Krieg“ war der Soundtrack dieser Jahrzehnte.
Die volatile Lage dieser Tage wirft mich zurück in diese Zeit. Heute wird darüber diskutiert, wie man vorausschauend in einer Gefährdungslage lebt. Selbst Nicole Deitelhoff, die Leiterin des Leibniz-Institutes für Friedens- und Konfliktforschung, spielte schon mit dem Gedanken, sich systematisch Vorräte anzulegen. Die Wehrpflicht wird wieder andiskutiert. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe plant eine Million Schutzräume in Deutschland. Nicole Deitelhoff sieht zwar aktuell keine Anzeichen für ein Übertreten der roten NATO-Linie durch Putin, keine Nuklearstreitkräfte, die sich bewegen oder Abschussrampen, die verlegt werden und auch atombestückten U-Boote, die ihre üblichen Pfade verlassen; aber doch, nun ja, auch die Leiterin des Leibniz-Institutes hat auch schon einmal darüber nachgedacht, das Land zu verlassen. Aussagen von denjenigen, die an der Quelle der Information sitzen, stimmen nachdenklich.
Bin ich gegen Kriegstüchtigkeit? Ich bin jedenfalls keiner der politischen Beobachter, der anfängt, Aufrüstung und Armee unkritisch zu vergotten. Doch ich bin für Verteidigungsfähigkeit. Der Schutz Deutschlands und Europas wurde lange Zeit an die Amerikaner ausgelagert, diese Zeit ist vorbei und es ist nur fair anzuerkennen, dass es diesen Schutz nicht umsonst gibt.
Es gibt nun drei Arten der Reaktion auf diesen Befund. Da ist zunächst einmal die Fraktion der Mahner: Neitzel, Masala, Strack-Zimmermann, Münkler und andere, die sich schon länger mit militärisch-strategischen Fragen beschäftigen werden nun, wie einst Virologen, als Fachpersonal für medial-politische Beratung auf den Plan gerufen. Ihnen fällt die Aufgabe zu, mit zugespitzten Thesen eine quasi-dekadente Boomer-Generation und ihren Nachwuchs aus Schwabing und dem Prenzlauer Berg auf ungemütlichere Zeiten einzustimmen.
Mit dieser Gruppe im Ellenbogen eingehakt marschiert eine wirtschaftspolitisch ausgerichtete Fraktion, die das Problem der im Grunde nicht vorhandenen Verteidigungsfähigkeit ökonomisch lösen will. Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und einige Rechentricks haben dafür gesorgt, dass die Bundesrepublik die neue Untergrenze der Allianz knapp halten konnte. 90,8 Milliarden Euro standen zur Verfügung und damit 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wehrtüchtiger oder gar „kriegstüchtig“ machen diese Ausgaben das Land nicht, ferner werden 2027 die Mittel des Sondervermögens erschöpft sein. Das neue Bundeskabinett wird den aktuellen Wehretat deswegen drastisch anheben müssen. Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, hält eine Ausgabe von fünf Prozent des BIP für die Verteidigung für unrealistisch, schätzt aber eine sinnvolle Investition in einer Größenordnung von drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ob drei oder vier: Geld ermöglicht frische Ausrüstung und Infrastrukturen, über Geld läßt sich ein Teil des Problems lösen.
Aber da wären ja noch die Menschen. Die potentiellen Soldaten; das Buch von Ole Nymoen „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Gegen die Kriegstüchtigkeit“ hat diese Debatte angestoßen, und hier wären wir bei der dritten Gruppe: die potentiell direkt Betroffenen. Also Vertreter der Generation, aus der sich die Soldaten rekrutieren würden bzw. auch die Elterngeneration, die ihre Söhne an die Front ziehen lassen müssten, nachdem sie noch ein letztes Mal Reinhard Mey („Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“) auf die Spotify-Playlist gesetzt haben. Hier nun wird die zuvor abstrakt-normativ geführte Debatte über Notwendigkeit und Finanzierungsmöglichkeiten von Wehrfähigkeit plastisch: hier kommt’s zum Schwur.
Auf die Frage der FAZ, ob Nicole Deitelhoff die Einstellung des siebenundzwanzigjähigen Podcasters Nymoen nachvollziehen könne, also sich einfach der Verteidigungspflicht zu entziehen, verneinte sie dies; sie fände die Position zwar legitim, würde sie aber nicht teilen. Für Nymoen nimmt sie an, dass es für ihn eben nicht das höchste Gut sei, in einem Land mit einer selbst gewählten Verfassung zu leben, sondern seine individuelle Freiheit im Sinne von: leben zu können wichtiger sei. Jungen Leuten müsste aber gesagt werden: Wollt ihr so wie eure Altersgenossen in Russland leben?
Lieber weniger frei als tot, sagt Ole Nymoen. Grundsätzlich gibt es in Deutschland ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das besagt, dass niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden darf. Von daher ist es wenig überzeugend, wenn Kritiker Nymoens wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk darin eine rein „hedonistische Position“ sehen oder der Islamforscher Reinhard Schulze sogar von „narzistischer Empathielosigkeit“ spricht. Dass die heutige Generation aus Kindern einer Überflussgesellschaft, einer Hochsensilibisierungsgesellschaft besteht wie es Richard David Precht formulierte, kann man sogar mit Abstrichen wertneutral konstatieren. Aber es geht ja nicht nur um Verweichlichung: Die Entscheidung, „kampflos in die Unfreiheit“ zu gehen, hat mehrere Schichten. Hier gibt es einerseits die klassische linke Frage, die das Thema aufwirft, wer eigentlich für wessen Freiheit kämpfen würde? Krieg als Klassenfrage: Welches Humankapital wird im Falle des Falles eingesetzt? Meistens sind es ja nicht die Kinder von Abgeordneten, Konzernvorständen, Talkshow-Gästen, die im Schützengraben landen, sondern die von Verkäuferinnen, Paketboten und Pflegekräften. Geld und Einfluss steigern die Wahrscheinlichkeit, seine eigenen Kinder vom Wehrdienst befreien zu können. Aber in Deutschland gebe es ja das Kriegsdienstverweigerungsrecht, ließe sich einwenden. Das gab es in der Ukraine auch, antwortet Nymoen, das wurde aber gekippt und wer es momentan in Abspruch nehmen will, käme dennoch ins Gefängnis oder an die Front. Wer weiss, wie sich in NATO-Staaten die Lage entwickelt.
Die Klassenfrage ist nicht von der Hand zu weisen. Etwas mehr als 180.000 Soldatinnen und Soldaten dienen gegenwärtig in der Bundeswehr. Nicht genug, wenn Deutschland die künftigen Nato-Planungsziele erfüllen soll, denn aus Sicht des Verteidigungsministers wären ca. 60.000 weitere Soldatinnen und Soldaten in der aktiven Truppe nötig. Woher sollen die kommen? Lediglich 19% Prozent aller befragten wehrfähigen Deutschen wollen einer Forsa-Umfrage zufolge ihr Land mit der Waffe verteidigen, wir haben Fachkräftemangel allerorten, wo so viele junge Rekruten aufgelesen werden sollen, ist vollkommen unklar.
Abschreckung, so sieht es eine Forschungsgruppe Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik, funktioniere dann am besten (oder scheitert am deutlichsten), wenn alle genau wüssten, was auf dem Spiel stünde – wie viel Schaden und welche Kosten jede Seite bereit wäre zu tragen, um das zu erreichen, wofür gekämpft werden müsste. Nur sind solche Faktoren im Vorhinein nur schwer einzuschätzen. Die Akteure haben oft innen- und außenpolitische Interessen, die Gegenseite diesbezüglich zu täuschen, was zu Missverständnissen und im schlimmsten Fall zu ungewollten Eskalationen führen kann. Ein prägnantes Beispiel war Japans Angriff auf Pearl Harbor 1941. Die japanische Führung glaubte, ein vernichtender Schlag gegen die US-Pazifikflotte würde die USA vom Kriegseintritt abhalten. Tokio unterschätzte jedoch die Entschlossenheit der USA, ihre Interessen im Pazifik zu verteidigen, sowie deren industrielle Überlegenheit. Ebenso fehlte es an Verständnis für die amerikanische Mobilisierungsfähigkeit und Kriegsbereitschaft nach einem direkten Angriff. Entscheidend für die Abschreckung ist auch die Fähigkeit der Beteiligten, sich nicht nur an Vereinbarungen zu halten, sondern andere davon zu überzeugen, dass sie diese später nicht brechen werden. Solche Zusicherungen sind nicht unmöglich, aber alles andere als selbstverständlich. Diese von der SWP angeführten Beispiele zeigen Fehleinschätzungen und, dass eine Abschreckungsstrategie nur dann funktioniert, wenn Ankündigungen Taten folgen können. Die Fehleinschätzungen Japans bezogen sich auf ein Unterschätzen der Entschlossenheit der Gegenseite – eine ähnliche Situation erlebten die Russen, die offenbar auf die Widerstandsenergie der Ukrainer nicht vorbereitet waren. Alles in allen: Nicht die Modernität der Waffensysteme allein entscheidet Kriege, sondern auch die Motivation und Zähigkeit, kämpferische Handlungen bis zur letzten Konsequenz durchziehen zu wollen.
Die Argumente, die derzeit noch dafür aufgebracht werden, um der scheinbar postheroischen Verweigerungshaltung den Sinn von militärischem Selbstengagement entgegenzusetzen, sind eher dürftig. Selbst in der taz wird zur Kriegstüchtigkeit gemahnt: Die Haltung von Nymoens zeuge von „Naivität“, so Simone Schmollack unlängst, Nymoen, der 1998 Geborene, der ein privilegiertes Leben in einer Demokratie führe, hätte, so Schmollack, keine Ahnung von einem Leben in Unfreiheit. Sie wiederum hatte ein solches unfreies Leben in der DDR erlebt – mit verwanzter Wohnung und Dissidenten, die in Stasigefängnissen weggeschlossen wurden, inklusive. DAS wäre die Unfreiheit in einer Diktatur, und wer dieses Leben kenne, so wie die Ressortleiterin, müsse sich eigentlich für einen Kampf gegen die Diktatur, notfalls mit Waffen, entscheiden. Dass die Staatsführung der DDR allerdings nie mit militärischen Mitteln bekämpft wurde, sondern in einer friedlichen Revolution zu ihrem Ende fand, bleibt in dieser Argumentation unerwähnt. Eher war es so, dass gerade nur sehr wenige Ost- oder Westdeutsche zur Absetzung des DDR-Regimes ihr Leben aufs Spiel gesetzt hätten. Als überzeugendes Argument, für das Wertesystem der NATO die eigene Söhne auf das Schlachtfeld ins Baltikum zu schicken, kann die DDR also kaum herhalten.
Ich habe Mitleid mit der Wirklichkeit. Die Hoffnung, ein beschauliches Leben unter einem französisch-europäischen Nuklearschirm zu verbingen, bringt mich in den nächsten Tag. Vielleicht besteht meine Aufgabe darin, wie ein Wilder einer Erwerbsarbeit nachzugehen, damit ich die 16 Atom-U-Boote, die vor Cherbourg im Ärmelkanal kreisen, mit dem aus meinem Tun generierten Steuergeld co-finanzieren kann, in der Hoffnung, dass sie ausreichend abschrecken. Was passiert, wenn der Tag der Entscheidung kommt, weiss ich noch nicht. Ob ich mich verteidigen werde wie ein freiheitsliebender Schweizer, der plötzlich – im Anblick des Feindes – augenblicklich zurück in sein Chalet huscht, um seine im Schrank versteckte Ordonnanzwaffe zu greifen, weiss ich noch nicht. Ich muss mir das noch bis zum Herbst überlegen. Bis im Osten was Neues passiert.