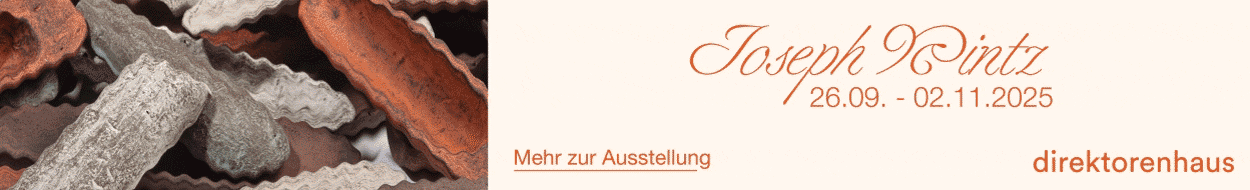Gegen Mitternacht hatten wir, mit etwa 70 Meilen Geschwindigkeit schnell vorankommend, den 20. Grad westlicher Länge erreicht. In der Funkkabine wurde gerade eine Wettermeldung aufgenommen, aus der hervorging, dass westlich von Schottland ein Sturmtief liege und vermutlich in nordöstlicher Richtung weiterwandere. Unter uns tauchten die ersten Gletscher und schneebedeckten Berge der großen, weit zum Nordpol vorgeschobenen Inselgruppe auf, die ihr österreichischer Entdecker Payer nach dem damaligen Kaiser Franz-Joseph-Land getauft hatte. Die Mittagszeit kündigte sich an. Ich wendete mich den weißgedeckten Tischen des Speiseraumes zu. Der Kommandant änderte den Kurs leicht, und dachte ich an meine eigene schmerzhafte Kurskorrektur, die ich in einer fast unmöglichen Doppelstrategie meinen Beteiligungen zugemutet hatte. Das „Time“-Magazin hatte mich daraufhin nicht mehr zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt mehr gezählt. Als die Performance meiner Firmen…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.