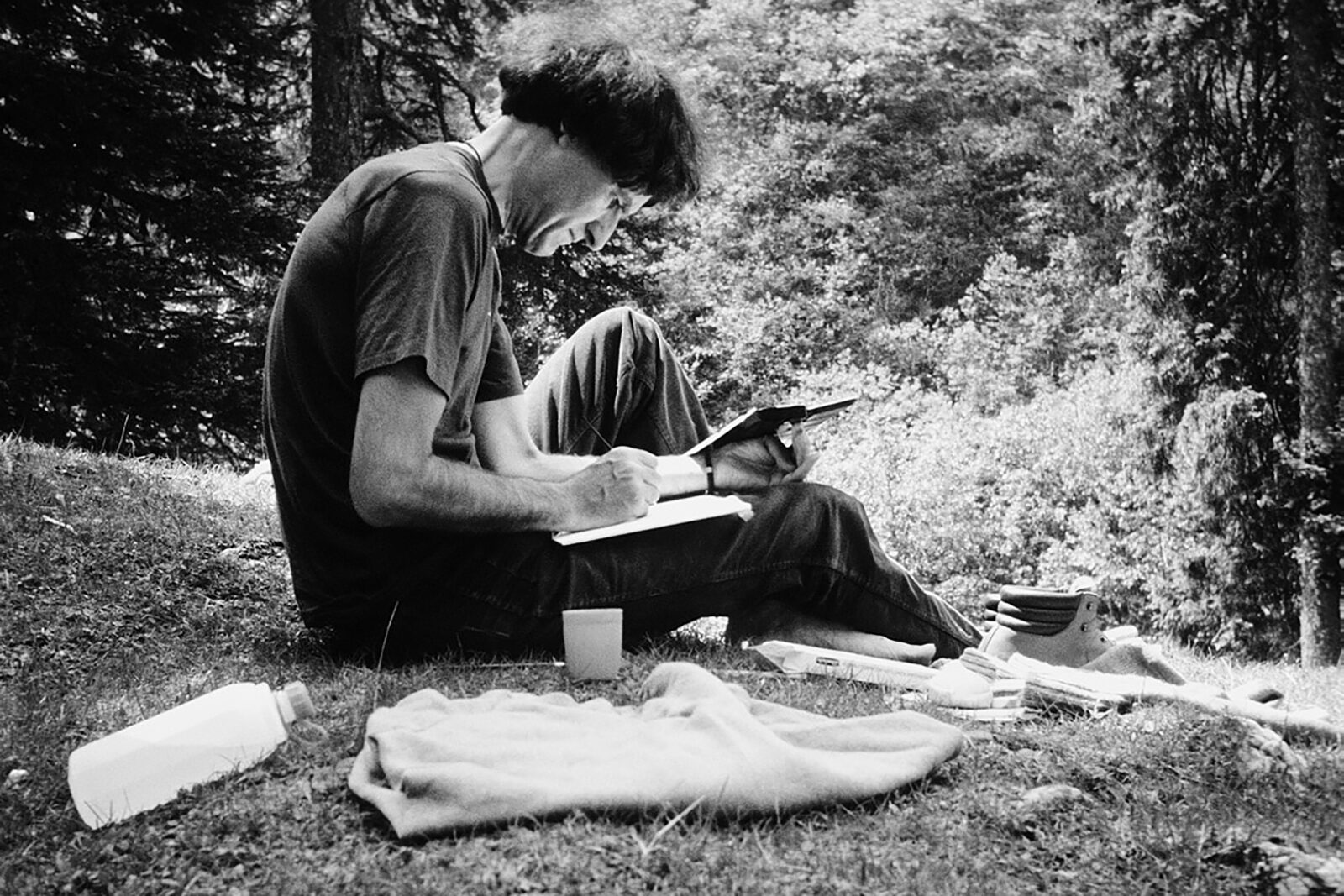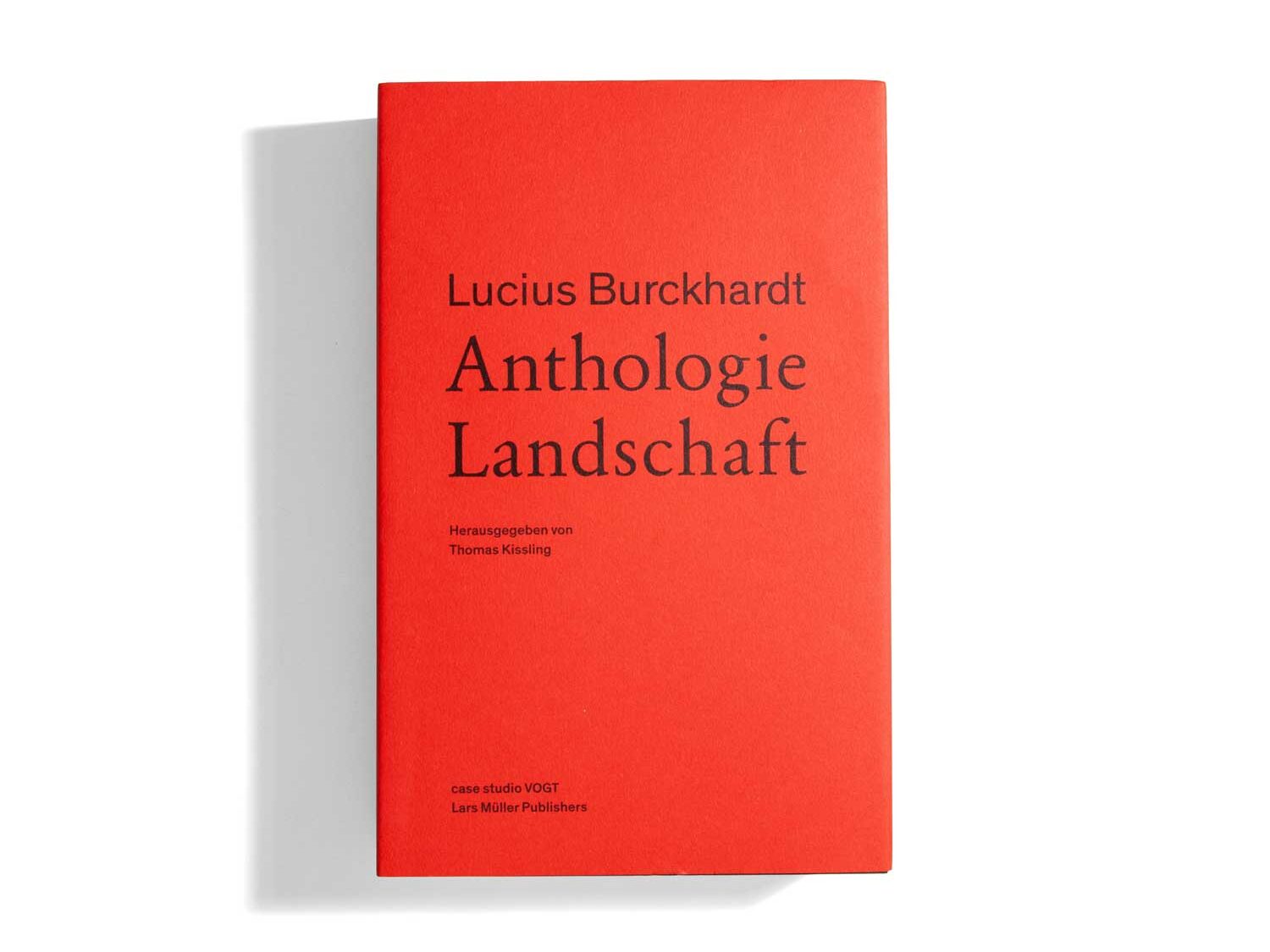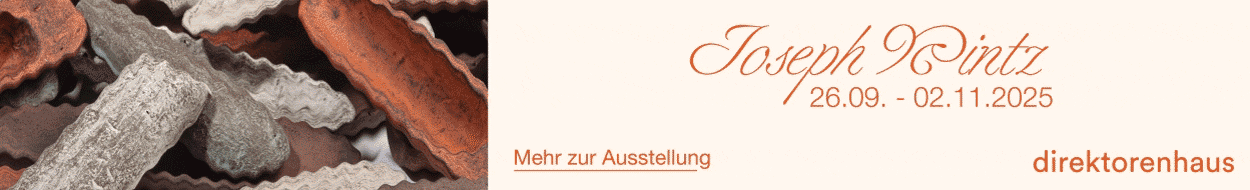Sehr geehrte Windrad-Lobbyisten, ich wende mich heute mit einer Frage an Sie. Die Frage lautet: Was macht Landschaft aus? Ich bin oft im Oderbruch, einem Landstrich bei Berlin, der schon Großartiges für die Flächenbereitstellung für Wind- und Solarenergie geleistet hat; der Landkreis Märkisch-Oderland hat gewissermaßen sein Plansoll übererfüllt. Der Landrat macht sich damit allerdings nicht nur Freunde. Neulich war ich Zeuge einer kommunalpolitischen Sitzung, bei der sich Windkraftgegner und -befürworter fast an die Kehle gingen. Jetzt, wo Ortschaften bisweilen schon komplett von Windkraftparks eingekesselt sind, liegen die Nerven blank. Als zum Beispiel zu Beginn dieses Jahres im oberschwäbischen Mittelbiberach neue Windkraftanlagen geplant wurden (ich war zufällig zum Familienbesuch in der Gegend) schaltete sich – nachdem einige Anwohner Befürchtungen über die ästhetische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes geäußert hatten – der Vorstand des…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.