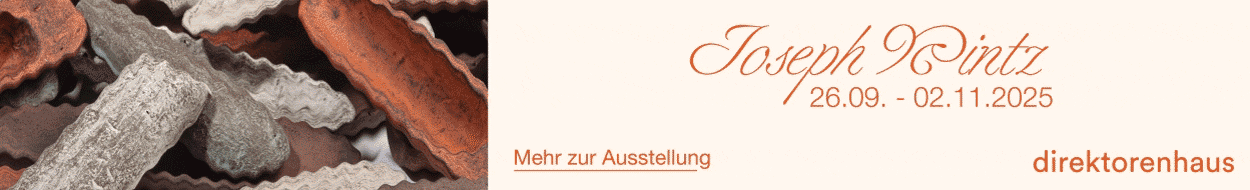Mein Leben hatte lange Zeit etwas Feierlich-Schleppendes, ohne besondere Auswirkungen auf irgendwen oder irgendwas. Ich wollte nichts entwerfen, bauen oder zerstören. Es stellten sich keine Wunder ein. Vor vielen Jahren hatte ich eine Galerie eröffnet. Ich bezeichnete mich fortan als Galerist, ohne ein tatsächliches Interesse am Kunsthandel zu haben. Die Galerie war nur mein Schutzraum gegen die Hässlichkeit der Welt. Mit meinen Ausstellungen wollte ich die Welt auf meine Weise interpretieren. Sie waren für mich eine Form des privaten Abenteuers, etwas, was aus dem Zusammenhang des Lebens kurzzeitig herausfällt, aber nicht zufällig geschieht.
Zwischenzeitlich ging ich in der Erkundung der Möglichkeiten meiner Galerie so weit, dass ich sie eine Woche lang nur nachts öffnete und in einer spektakulären Aktion mit Wasser flutete. Später entwickelte ich einen schwimmenden Ausstellungsraum an den Ufern von Castello, um für die Kunstsammler unübersehbar zu sein, wenn sie ihre Paläste verließen. Als Händler schuf ich ein umfangreiches Beziehungsgeflecht, das gleichzeitig den Wettbewerb eindämmte. Nur wenige Künstler verließen meine Galerie, was auch Folge meines Aufstiegs war. Ich wurde zum Begründer einer Kunstströmung und zog eine Künstler-Generation heran, deren Programmatik es sein sollte, den gesamten Kunstmarkt zu zerstören. Ich verfügte über Galerien an zahlreichen Boulevards, doch bevor der Kunstmarkt implodierte, schloss ich alle Filialen. Ich verschenkte mein Erbe und ließ mich von meinem Chauffeur aus der Stadt fahren.
Zeit meines Lebens hatte ich mich auf Außenseiteraktivitäten spezialisiert. Als auch die nicht richtig vorankamen, beschloss ich, mich nur noch kunstgerecht durchgeführten phänomenologischen Überlegungen hinzugeben und zog mich in den Mythos zurück. Ich wollte in die Zeit der reinen Beschreibungen eintreten und mir die ablaufende Lebenszeit nicht mit operativen Maßnahmen vollstellen.
So fasste ich den Entschluss, zum Black Mountain College zu gehen. Diese Werkstätten! Ihr Ruf eilte allem voraus. Während die restlichen Schulen der Welt den Menschen auf das harte Leben der Tatenlosigkeit vorbereiteten, traten die Werkstätten entschlossen in die Welt. Wenn das Schöne der sich enthüllende Gott und der Künstler sein Priester sein soll, dann war das Black Mountain College ihr angelegter und heiliger Bezirk.
Was erwartete ich? Pädagogische Programmierung? Ich erwartete eigentlich nichts. Schwarze Strahlen der Versicherungskonzerne waren überall, Unbehagen, Verflüssigung aller Gewissheit und Blicke der Oliven, Kleidung mit Protestcharakter, das Rauchbier, Seriengründer mit grossen Ideen. Ich hatte die Randzonen der Stadt hinter mir gelassen, verschiedene Länder durchquert mit ihren zahllosen Voodoo-Priestern, Kardinälen, Mullahs und Montagehallen; nach einem wechselnden Panorama der Leere, bei dem sich das weite Brachland und der Himmel in langen Abständen nur minimal neu formatierten, erschienen plötzlich nach einer Waldbiegung die Werkstätten vor mir: da waren sie. Ich verschleppte den Gang. Wo ist dieser Ort, dieses kleine Nest, wo ich geboren bin? Wo nochmal? Ich ging die letzten Meter auf der Landstraße und dachte heiteren Herzens an die Zukunft. Ich war gut hydriert.
Die Werkstätten des Kollegs waren einem Kloster nachempfunden, als abgelegene intellektuelle Gemeinschaft. Das Gebäude, von der Größe eines Schlosses, lag inmitten eines Waldes nach Westen zu den Appalachen ausgerichtet. Das ehemalige Zementwerk aus dem 19. Jahrhundert umfasste drei Silos, die durch neue Erweiterungsbauten verbunden waren. In den übrigen Gebäudeteilen waren weitere Labore und Werkstätten untergebracht, ein Konzertsaal, die Bibliothek, die Kantine sowie die Schlafräume.
Man teilte mir ein Zimmer zu, die 308. Im Traum der ersten Nacht sah ich, wie Bauhäusler aus vierhundert Verschlägen herauskrochen und an den Kanzleitisch herantraten, an dem ein fetter und kahler Junge frittierte Hühnerflügel aß, während andere begannen, an seinem Tisch zu sägen und um ihn herum eine großzügige und luxuriöse Stadt emporwuchs. Es war alles ein bisschen verrückt und teilweise nicht zu glauben.
In den ersten Tagen empfand ich die Atmosphäre auf den Gängen als sprudelnd und frei von Überheblichkeit. Ich spürte einen frischen Wind, der etwas von Meeres- oder Gebirgsluft hatte. Es schien, als würde das Black Mountain College ausschliesslich Menschen anziehen, die imstande waren, in ihrem Bewusstseinsstrom einen mentalen Ausnahmezustand zu isolieren, einen fruchtbaren Moment, der ihnen das Sein ihres Dasein vergegenwärtigte. Doch irgend etwas war faul an der Sache.
»Für die Psycho-Hygiene der Schüler waren die Werkstätten jedenfalls eine Zumutung.«
Lovis Auerbach
Es war beim Vorkurs. Zwei Arbeitsinspektoren traten ein. Wie mir später gesagt wurde, kontrollierten sie Tag und Nacht die Räume und achteten auf die Einhaltung der Vorschriften, insbesondere der hygienischen Sorgfalt. Auf die Lippen der Inspektoren hatte sich das ruhige Lächeln der örtlichen Sitte gelegt. Das eine Milchgesicht blickte um sich, mit dem kreisenden und langsamen Blick eines Feldjägers. Er kauerte sich in die Ecke des Kursraums und blieb bis zum Abend, woran niemand Anstoss zu nehmen schien.
Das komplexe Überwachungssystem wurde jeden Tag sichtbar. Das College erschienen wie ein magischer Staat, der vom eigenen Rechtsglauben so durchtränkt war wie Nationen und Kirchen. Ihr Anspruch zielte auf die Einheitsschule, die alle schöpferischen Kräfte aus angewandter und freier Kunst zusammenzog. Unter der spielerischen Oberfläche verbargen die Werkstätten einen inneren Richtungssinn, der sich nur historisch erklären lies; war nicht die vom Jugendstil hervorgebrachte Idee einer gesamtkünstlerischen Gestaltung der Welt ein ästhetisches und am Ende auch autoritäres Regime? Das Black Mountain College war wie eine atmosphärische Insel, deren Klima unter hohem Aufwand gewartet werden musste. Nahrung, Versorgung, Verdauung, Binnenklima im Glashaus, die Nest- und Nischenbildung einzelner Forschungsgruppen und die ständige schöpferische Entfaltung brachten ihre Eigenheiten hervor.
Für die Psycho-Hygiene der Schüler waren die Werkstätten eine Zumutung. Ein geheimes Klassenprinzip lauerte überall. Es versteht sich von selbst, dass das geistige Klima an den Werkstätten keine idyllische Geborgenheit bot, sondern auf Wettbewerb hin konzipiert war. Wie auf Verabredung lenkten die Bosheiten der Inspektoren alle Ausschweifungen der Schüler wieder in kontrollierte Bahnen, um eine permanente Spannung zu erzeugen, die eine Erschlaffung der Seele, die die Individuen in allen sonstigen Bereichen der sonstigen Gesellschaft erfasst hatte, gar nicht erst aufkommen ließ. Hört auf, nur abgehobenes Zeug zu lesen, Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken. Trinkt viel Wasser, geht trainieren, bleibt wachsam. Das war ein geschickter Bluff, eine Täuschung, ein Spiel mit einem Bio-Machtkonzept. Aber es zeigte Wirkung. Die gefalteten Händen im Monogramm der Schule stellten das Himmelsgewölbe dar. Das Symbol hatte jeder Schüler an der Kleidung zu befestigen und war überall präsent.
Es gab vielfältige, einander widersprechende Hinweise, die keine vorschnellen Urteile über die moralische Integrität der Kunstschule zuliessen. Die Werkstätten hatten die Wirkung von Neuro-Architektur verstanden. Sie plante mit dem Wissen, dass das sinnliche Erleben sehr gestört wird, wenn alles nur über das Auge wahrgenommen wird. Die Klänge der Nacht, der Wind, das Atmen der Tiere, der Duft der Blumen bleiben leblos, wenn man sie nur über das Auge wahrnimmt. Die Reste anderer Sinneswelten (Klänge, Düfte, Wärme und Kälte) sollten für alle Schüler aus unmittelbarer Quelle erfahrbar bleiben. Dazu trafen die Werkstätten Vorkehrungen.
Zum Beispiel die versteckten Spieluhren. Spielten sie Bach? Oder Cage? Viele barocke Kriterien wie klare leuchtende Klangfülle, Terrassendynamik und ausgeprägte Plastizität der Stimmen gehörten zu den Eigenschaften der Geräusche, die ich nachts, auf den dunklen Gängen der Werkstätten wahrzunehmen glaubte. Sie piepsten und blubberten aus den in den Mauern versenkten Lautsprechern. Ich Wirklichkeit hörte ich wahrscheinlich nichts; die enorme Komplexität der Töne verhinderte ein Verfolgen der Verflechtungen einzelner Linien. Das, was ich hörte, war eine getreue Wiedergabe meines Mindsets. Aber es ginge zu weit, den reinen Klängen therapeutische Wirkung zuschreiben zu wollen. Ich ging auf mein Zimmer.
So floß meine Zeit am College dahin. Oft traf man mich in der Bibliothek, in der ich mit faschingshafter Fröhlichkeit in die Nachmittage hineinlebte. Aus ihrer Tiefe blitzte an jeder Stelle die menschliche Kreativität auf. Die räumlichen Durchblicke auf den Ozean und der Lichteinfall auf die Lesearbeitsplätze wirkten isotonisch. Im Frühling, zur Zeit der Algenblüte, konnte ich von meinem Platz aus die tannige Waldluft aus den Appalachen riechen.
Im Inneren der Bibliothek wirkte die Verwendung von Stein, Holz und Linoleum beruhigend. Die Gleichfarbigkeit der Bucheinbände unterstützen diesen Eindruck: die Werkstätten hatten den Magazinen durch eigens angefertigte Buchrücken eine wohltuende Einheitlichkeit verliehen. Unter den 6000 Bänden der Sammlung fanden sich prächtige Renaissance-Einbände und Originalausgaben großer Typografen. Das Archiv erinnerte daran, dass es nach wie vor, aber nur an wenigen Orten dieser Welt, solide kleine Sammlungen gab, die ohne Spekulationsinteresse gewachsen waren, beseelt von gutem Geschmack und tiefen kulturellem Wissen, beschützt von wissenschaftlicher Neugier und der Diskretion des seriösen Handels. Verzweifelte Europäer hatten diesen Schatz hierher gebracht.
Das Herzstück der Sammlung bildete eine Wand mit Bänden zur zeitgenössischen Architektur- und Designtheorie. Man fand hier: Schriften von Samuel Smiles, Alexis de Tocqueville, Frank Lloyd Wright natürlich, Hermann Muthesius, Adolf Loos und John Ruskin, Bände der Reformer um Ellen Gates Starr oder Vladimir Tatlin, „Exotisches“ über das indische Kunsthandwerk von Kamaladevi Chattopadhyay oder – ganz gegensätzlich – das „Digital Artisans Manifesto“ von Richard Barbrook und Pit Schultz. Allesamt waren das bereits die Klassiker des 20. Jahrhunderts, der Kanon, ebenso wie die flankierenden Schriften zur Lebensreform der 20er Jahre, die ich verehrte, zeitlos schön: „Der Naturmensch Gustav Nagel als lebensreformerisches Gesamtkunstwerk.“
Ein Materialarchiv gab es im Kellergeschoss auch; es war voll von organischen Pilzen, die sich dreidimensional im Substrat ausdehnten. Die obskuren Formen wandelten mithilfe von Enzymen totes organisches Material in nutzbare Energiebausteine um. Blaue und silberne Rosenseitlinge standen wie römische Skulpturen in einer Säulenhalle herum, die mit ihrer weitgespannten Vernunft meinen Träumen Natürlichkeit verliehen.
Eines Tages, als ich auf meinem Platz mit aller Aufmerksamkeit, die einer solchen Untersuchung zukommt, die Laibung eines Fensterrahmens betrachtete, stand mein erstes Treffen mit Twombly an. CyTwo – wie ich ihn nannte – gehörte zur Gründungsgeneration der Werkstätten und leitete die Designtheorie-Klasse. Er war bereits eine lebende Legende, eine Vollnatur, ein Machtmensch, ein bäuerliches Kraftgenie. Was würde mich erwarten?
Die Designwissenschaft war vor Jahren schon zur Leitdisziplin der Zukunft erkoren worden. Man war sich an den Werkstätten einig, dass Design eine Haltung verkörperte, die auf einem komplexen Verbund von technologischen, sozialen und ökonomischen Belangen basierte. Man begnügte sich schon lange nicht mehr mit der Gestaltung von Einzelobjekten, sondern verlagerte das Interesse auf Gesamtsysteme. Design sollte in seiner Essenz nicht als materielle, sondern ideelle Tätigkeit verstanden werden. Die Werkstätten hatten dazu prägende Lehrer wie CyTwo hervorgebracht, die wie Heilige den Verstrickungen des realen Lebens entkamen. Sie waren die Kentauren. Sie spielten in den Werkstätten ihre Rolle, wie Schauspieler, die eine Wirkung auf ihr Publikum erzielen wollen. Die Inszenierung lief wie eine gut geölte Maschine. Alles, vom Ganzen bis hin zu den geringfügigsten Einzelheiten, entsprach einander. Die Bewegungen, ihre Auftritte und Abgänge, ihre Zusammenstöße, ihre Begegnungen wurden ein für allemal mit einer gewissenhaften Präzision festgelegt, die möglichst bis zum schlichten Zufall alles vorhersieht.
CyTwo zeichnete sich wie viele Lehrer der Werkstätten durch Vielseitigkeit aus, war Konzeptkünstler, Bildhauer und Wandgestalter. Den Gerüchten zufolge war er wohl auch Balletttänzer gewesen. Für ihn war das Bild des Menschen als psychophysische Einheit Ausgangspunkt aller Bemühungen. Sein künstlerisches Ziel war es, Zivilisationskritik in Zustände höchsten Glücks zu verpacken, Zustände, die den meisten Leuten fremd waren und höchstens kurzzeitig, zum Beispiel beim Orgasmus, auftraten.
Noch als Student hatte CyTwo zusammen mit einem befreundeten Architekten ein Kunst- und Architekturbüro gegründet, das sich mit großformatigen Kunstwerken für den öffentlichen Raum beschäftigte. Als erste Werke entstanden oszillierende elektrische Ventilatoren, die von der Decke einer Landesbank hingen. Einige Ventilatoren schwangen vor und zurück, drehten sich dabei um seine eigene Achse und fielen an nicht vorher bestimmbaren Momenten auf die Bankbesucher herab. Das Projekt war eine provozierende Antwort auf die Thesen eines jungen Philosophen, der in seinen Essays eine neue Ethik der Intensivität heraufbeschwor und damit eine große zeitgeistige Wirkung entfaltet hatte, obwohl niemand ihn verstand, sondern jeder nur vermutete, dass es um fehlende Resonanz und andere gestörte Weltbeziehungen gehen musste. Statt der Vergütung für die aufwändige Installation erhielt CyTwo von der Bank eine Strafanzeige wegen versuchten Totschlags. CyTwo war’s egal: Wenn die öffentliche Ordnung ihm Hürden setzte, dann hat er die einfach umgerannt.
CyTwo war so etwas wie der Symbolist unter den Gestaltern. Er hatte etwas von Wagner, auch von László Moholy-Nagy. Richard Wagner hatte ja seinerzeit als Prophet und Bilderstürmer das Musikdrama erneuert und gefordert, die dramatische Kunst solle wieder zu ihren weit entfernten Quellen zurückfinden, wo sie genährt würden vom Traum, vom Archetyp; CyTwo ging im Feld des Designs, auch in der Kunst, ähnlich vor. Er mystifizierte die Kraft der Gestaltung und versuchte, die Herrschaft des Realismus immer weiter zurückzudrängen. Die Gestaltung der Welt war für ihn keine fortgesetzte Problemlösung, sondern die Schaffung eines unregulierten Raumes voller assoziativer Zeichen und Symbole; die Konfrontationen mit Objekten und gestalteten Situationen sollten im Menschen emotionale, auch irrationale Reaktionen hervorrufen, die im Reich der Phantasie und des Unbewussten einen Widerhall wecken.
In der Realität tat sich CyTwo freilich schwer. Im nachfolgenden Projekt „Red River“ färbte er das Wasser von Flüssen an verschiedenen Orten der Welt mit einem roten Farbstoff ein. Das sah imposant aus. Als unmittelbare Folge des plötzlichen Fischsterbens aber, das CyTwo nachträglich als eine von der Kunstfreiheit gedeckte Kritik am industriellen Fischereiwesen erklärte, wurde er verhaftet. Er saß ein. CyTwo wurde ins Tent City Jail verfrachtet und musste rosa Handschellen tragen. Hier wie überall vermengte sich Bekenntnis und Widerruf, und es hätte ihm besser gefallen, wenn er allein auf der Insel Alcatraz gesessen hätte. Aber so war es nicht; seine bunte Welt, die er bis dahin durchwandert hatte, reduzierte sich auf wenige Quadratmeter. Auf diese Weise rächte sich das Zornkollektiv der mittleren Klasse an ihm, dem Freigeist.
Nach der Entlassung zog sich CyTwo in einen Kurort zurück, an dem er sich aryuvedischen Massagen unterzog. Er wollte leben, sein Mantra neu aufsetzen. Gleich im Anschluss an die Kur bekam er unverhofft den Auftrag, anläßlich eines Jahrestages der Europäischen Kommission ein interaktives Kunstwerk zu schaffen. CyTwo entwickelte vor dem Parlament ein vielstimmiges Werk mit Kindern in diversen Sprachen, um mittels datenbasierter Vernetzung zentrale Themen wie Umwelt, Artensterben bis hin zur Klimapolitik aufzubereiten. Für das Werk wurde er leidlich bezahlt, so dass er später der Presse berichten konnte, dass „dieses Spektakel wirklich das langweiligste, unsinnigste und folgenloseste Projekt“ seiner ganzen Laufbahn gewesen war. Am liebsten hätte er nachträglich diesen Auftritt komplett wegignoriert, aber dafür war es zu spät.
Danach wandte sich CyTwo ernsthaften Dingen zu. Als charmanter Manipulator der Massen hatte er die Menschen studiert und deren Abgründe weitgehend verstanden. Er wollte nicht mehr die Kunstmagd des Kapitals sein, sondern den Mechanismen der ästhetischen Sozialisation in ihrer ganzen Rätselhaftigkeit nachspüren. Er hatte begriffen, dass die klassische Kulturkritik ausgedient hatte. Design war nicht mehr dazu da, Alltagsprodukte verführerisch herausstechen zu lassen, um Konsumenten zu erotisieren. Konsumenten waren mittlerweile vollständig ernüchtert, das Resultat eines unbemerkten, schleichenden Prozesses, so dass sie nun in der Lage waren, ihre Angelegenheiten möglichst widerstandslos zu bewältigen. Ich sollte CyTwo erst später treffen.
Meine Abende am Kolleg waren einsam – wie gestern zum Beispiel. Der Abend brach an und auf alles senkte sich Stille. Das Institut lag im Schatten der Dämmerung, von den Appalachen wehte ein dunkelblauer Duft von Ahorn und Kastanien herüber. Mit ihren Ausläufern verbanden mich die Berge mit dem Missisippi und Neufundland auf einer Linie. Ich ging auf mein Zimmer, das wie ein geschützter Winkel im Westflügel der Gebäudeanlage lag. Ich warf mir ein frisches Hemd über und ging zum Speisesaal.
Der nur noch dunkel ausgeleuchtete Saal war weitgehend leer. Am Fenster saßen in etwas Entfernung zwei jüngere Kollegen, die kurz grüßten. Waren es CIA-Leute? Eine Aufwärterin kam mit dienstfreundlichem Gesicht an den Tisch und dem Servierwagen, auf dem eine Reihe kleinerer Speisen präsentiert wurden, von denen ich zwei Teller und einen Wein wählte.
Die gastronomische Frage war am Institut klug gelöst: die Notwendigkeit nach Rationalisierung war mit einem modernen kulinarischen Wissen vermählt worden. Achille, ein introvertierter Australier, hatte die Küche vor einem Jahr übernommen und ihr seine Handschrift verliehen; er bewerkstelligte die Arbeit zusammen mit seinem Sohn. Ich dachte daran, wie Achille mir einmal ein Gericht vorsetzte, das nicht nur nach Meer schmeckte, sondern auch so aussah. Die Basis war ein kleiner Berg aus fast noch rohen Venusmuscheln und einer Sojamilchcreme; Achille hatte die Muscheln nur kurz gedämpft, damit sie sich öffnen, und den austretenden Saft nutze er als Grundlage für die Sojamilchcreme, über die gedämpfte und in Scheiben geschnittene Garnelen und kleingehackte Venusmuscheln gestreut wurden. Aus den Körpern der Garnelen hatte er ein durchsichtiges Gelee zubereitet, das er, sobald es fest geworden war, in kleine Stücke schnitt, um damit die Lücken zwischen den Meeresfrüchten zu füllen. Ben wollte mit diesem Gericht Kindheitserinnerungen an das Meer hervorholen, seine Sehnsucht kulinarisch rekonstruieren.
Für die perfekte Meeresflora hatte er dazu selbst frische wilde Pflanzen aus dem Meer gesammelt. Mehrere Tage lang lief mit seinem Sohn den Strand auf und ab auf der Suche nach irgendetwas. Dann fand er drei Elemente, die ihn inspirierten: Erstens eine essbare Alge, die Meersalat genannt wird und deren Farbe, Konsistenz und Aroma Schlüsselelemente seines Konzeptes wurden. Zweitens eine graue Melde, die an der Küste wächst und seit Urzeiten als Buschnahrung dient. Achille verwendete sie mit ihrem zarten Aroma hier als Gewürzkraut, wobei ihre ledrige Textur einen bewussten Kontrast zu der samtigen Creme darstellt. Die dritte Zutat schließlich war der Queller – eine Salzwiesenpflanze, auf die ihn eine ältere Frau auf seiner Wanderung hingewiesen hatte. Queller ähnelte dem Meerfenchel, schmeckte aber zarter und saftiger. Achille hatte mir diese Geheimnisse in einer abendlichen Laune anvertraut.
Heute sah ich einen Teller mit Möhren, Möhrensaft und Maronen vor mir. Der Clou der Komposition musste wohl das Möhrendestillat sein, das man nur mit einem Rotationsverdampfer hinbekam. So war alles trefflich eingerichtet. Ich verstand mich längst als willfährigen Zögling eines kulinarischen Umerziehungsprogrammes, denn auch ich hatte eine Vergangenheit hinter mir, die ich zum Teil mit Essen von verheerender geschmacklicher Qualität verbracht hatte. Wie oft hatten die Gerichte der Restaurants wässrig und leer geschmeckt, manche Soßen sogar nach wenigen Sekunden im Mund gebrannt vor lauter Würze und Salz. Viele Erfahrungen mit stumpfen und matten Aromen hatten mich deprimiert. Fast hätte ich geglaubt, dass ein Leiden mich meiner Geschmackssinne beraubt hätte, aber nein, es war das Essen, das keine aromatischen Spitzen bereithielt, bei denen ich ein Element wirklich einmal hätte durchschmecken können. Selbst an den von der Presse gefeierten „kleinen Orten, an denen Großes passiert“, die mit zeitgeistigem reduktionistischen Ansatz und pointiert nachlässig gestalteten Menükarten als „Restaurants der Zukunft“ bezeichnet wurden, fand ich nichts Berauschendes, geschmacklich waren die Resultate bestenfalls diffus gewesen. Die schlimmste zurückliegende Erinnerung war die an einen Abend, bei dem ich eine Unsumme an Geld gegen außergewöhnlich pampig-elastische Fettuccine getauscht hatte, eine Erfahrung, die das abschließende Dessert nicht retten konnte, da es selbst eine seifige Nebennote aufwies. Das waren alles kunstvoll angerichtete, aber armselige Produkte für eine artifizielle Ernährungswelt.
So gesehen hatte mir Achille tatsächlich die Augen, oder eher: die Geschmacksknospen geöffnet. Zum ersten Mal war es mir möglich, einer ausgeweiteten Sensorik zu folgen, auch der räumlichen Regie einer Geschmacksfolge. Ich lernte, dass durch unterschiedliche Überblendungen und zeitlich gestaffelte Verläufe eine enorme Qualitätssteigerung des Esserlebnisses möglich war. Hatte ich Achilles Experimente zu Beginn noch als kreative Marotte abgetan, da ich selbst (ohne es zu wissen) penibel darauf achtete, dass mein Essen keinen Millimeter von den gewohnten Erwartungen abwich, musste ich einsehen: Ich hatte in der Vergangenheit im Dunklen gelebt, im stockdunklen Schwarz, jetzt war ich ein Sehender. Achilles Essen war für mich ein positiver Schock; es schmeckte sensationell gut, hochfein, absolut frisch und duftig.
Ich musste an Josef Albers denken. In Black Mountain fotografierte er den Alltag auf dem Campus, ich hatte ihn vorgestern auf einem Erdbeerbeet getroffen und es entschlüpfte uns ein Gespräch über die Farbe „rot“, ein geistiges Training, das mich darauf vorbereitete, dass Albers auch beim Abendessen unterrichtete. Die Sommerkurse warfen ihre Schatten voraus. Albert Einstein sollte kommen. Erwin Panofsky, Merce Cunningham und Willem de Kooning. Wo soll Kunst entstehen, wenn nicht hier in der Natur?
Die besten Tage meines Lebens, das wurde mir in diesen Stunden im Speisesaal bewusst, hatten in meiner Brust eine Leerstelle hinterlassen. Die finanzielle Situation der Schule schien verzweifelter zu sein als es das Essen vor mir vermuten ließ. So der Buschfunk. Wer weiss schon, wie viele FBI-Agenten als Schüler eingeschleust worden waren? Wir waren keine Freunde von McCarthy, und man wusste das. Nachdem ich die Karotte beendet hatte, griff ich zum zweiten Teller, einen Schmortopf mit Gemüse, Huhn und Kräutern. Ich schaute aus dem Fenster in den dunklen Garten, dessen Grenzen nur durch ein fernes schwach blinkendes Licht am Badehäuschen auszumachen war. Jeder von Menschen bewohnte Erdteil hat einen Kahlschlag von Ökosystemen und Arten erlebt. Die meisten nordamerikanischen Gebiete haben Wölfe, Hirsche, Elche verloren, Braunbären, Panther, Bisons und eine Vielzahl von Fischen und Wildpflanzen, die es vor 400 Jahren noch im Überfluss gab. Bevor diese Arten verdrängt wurden, schlachtete man das Mammut, das Riesenfaultier, das Wildpferd. Warum nicht auch das Black Mountain College.
Die Eichhörnchen, Kaninchen und Sperlinge, die rund um unser Institut leben, waren weniger Beweise blühenden Lebens als die Überlebenden einer Apokalypse, ebenso wie die Koyoten, deren Population sich vergrößert hat und die nun Hühner und Welpen auf Neo-Hippie-Bauernhöfen außerhalb der Stadt reißen. Draussen war es kalt geworden. Ich trank aus und ging durch die Flure auf mein Zimmer. Hier war ich nun mit mir allein. Ich beschloss zu schlafen.