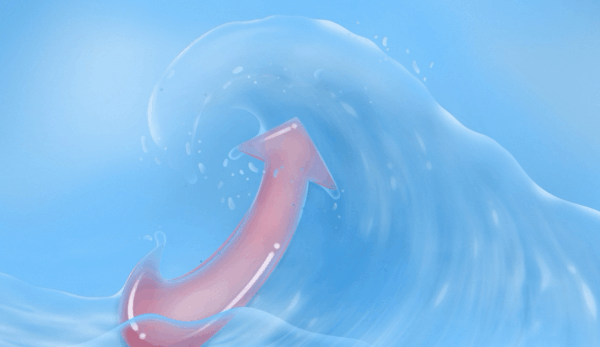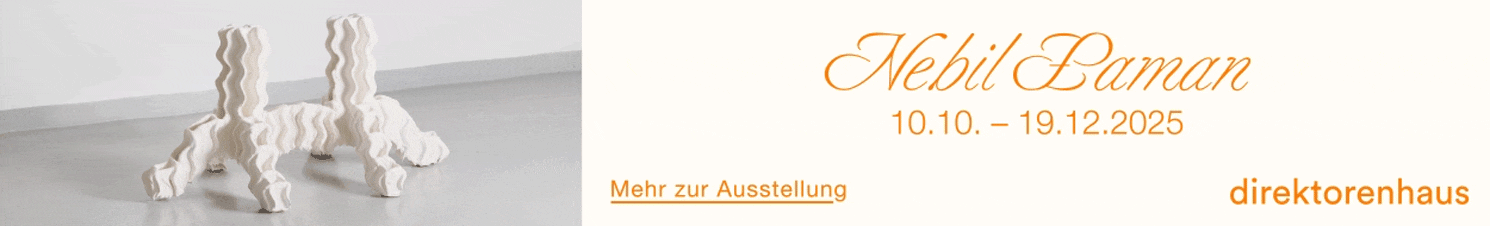Der Wald, in dem die Lösung für viele Zukünfte liegt, ist ein Bad. Bienenvölker durchsummen die Reviere. Eine Studierendengruppe aus Halle, die das Potenzial des Waldes verstanden hatte, machte sich auf ins Unterholz, um eine neue Motorsäge für die kleine Hand zu entwickeln. Sie kamen nicht mehr zurück.
Frederick Ostertag
Ich wollte immer im Wald leben. Die therapeutische Wirkung des Waldes auf Körper und Seele basiert auf Terpenen (ätherische Ölen), die aus der Rinde und Blättern von Pflanzen ausdünsten. Wenn ich sie über Haut und Lunge aufnehme, beruhigt sich mein Sympathikus. Der Ruhe-Nerv Parasympathikus, mörderischer Gegenspieler des Sympathikus, der der körperlichen Regeneration dient, erhöht seine Aktivität. Dieses Gefühl kann zur Droge werden.
Wer im Wald leben möchte wie Henry Thoreau, muss allerdings in der Wildnis übernachten. Schön und gut, aber wie? Ich liebäugelte mit dem Monolithen; das Monolith von EXØD ist ein Zelt für eine Person, das zwischen zwei Bäumen befestigt wird. Das besondere hierbei ist, dass dieses Zelt gänzlich ohne Stangen auskommt. Seine Statik erhält es durch Luftschläuche, die, wenn sie aufgepumpt sind, eine hohe Stabilität ergeben. Ich war offen für subversive Ideen, aber mir wurde klar, dass es noch etwas Besseres geben musste. Ein Dozent erwähnte das Tensile. Tentsile ist ein Baumzelt, das zwischen drei Bäumen aufgespannt wird. Durch die drei Punkte bekommt das aufgespannte Textil eine sehr hohe Stabilität. Über den aufgespannten Zeltboden kann, wie bei einem herkömmlichen Zelt, ein Insektenschutz und eine Plane gegen Wind und Regen gespannt werden.
Man darf nicht einfach so im Wald übernachten übrigens. Nach dem Bundeswaldgesetz ist das Übernachten im Wald nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Eigentümers gestattet. Man muss also schnell wegkommen können, wenn die Waldpolizei naht. Also lenkte ich meine kreative Energie dahin, ein mobiles System zu entwickeln, dass an einem gesunden Baum befestigt werden konnte; die Höhe der Zelte kann variabel gestaltet werden. Diese können unmittelbar über dem Boden befestigt werden, sodass ein einfacher Einstieg problemlos möglich ist, oder weit oben im Baum, sodass die Behausung nur über eine Leiter erreicht werden kann. Im Winter baue ich die Zelte ab.
Max Koch
Im Wald liegt die Zukunft, und man sollte die Rechnung nicht ohne diejenigen machen, die ihn bewirtschaften. Ich konzentrierte mich daher exemplarisch auf drei Gruppen: Forstwirt*innen, Jäger*innen und Zeidler*innen. Darüber hinaus wollte ich Perspektiven von Personen einbeziehen, die den Wald als Lebensmittellieferanten begreifen.
Eines Abends (ich stelle ihn mir gern als einen mondlosen, eisigen, trostlosen Abend vor!) las ich von den Zeidler*innen. Was waren das für Leute. Die Anfänge der Zeidlerei liegen im 7. bis 8. Jahrhundert – in einer Zeit, in der der Reichswald noch ein naturbelassener Mischwald war. Die Blütezeit dieser Waldwirtschaft darf man zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert annehmen, als Zeidler sowohl wilde Bienenvölker nutzten als auch gezielt Baumhöhlen und Klotzbeuten pflegten.
Kaiser Karl IV. gewährte der Zeidler-Zunft außergewöhnliche Sonderrechte: Zollfreiheit, Lehensfreiheit, eigenes Jagdrecht, geschenkte Höfe und sogar eine eigene Gerichtsbarkeit – eine juristische Selbstständigkeit, die außerhalb des Adels kaum zu finden war. In weinroter Amtstracht bewegten sich die Zeidler durch den Wald – als eine Art „Forstpolizei“ mit gesellschaftlichem Ansehen. Bemerkenswert ist auch, dass das Zeidlerrecht – anders als bei den meisten Berufen dieser Zeit – ausdrücklich erlaubte, das Wissen und die Praxis an Töchter weiterzugeben. Zeidlerei war damit einer der wenigen mittelalterlichen Berufe, die auch von Frauen ausgeübt werden konnten.
Die wirtschaftliche Grundlage der Zeidlerei bestand aus drei zentralen Produkten: Honig, Met und vor allem Bienenwachs. Während Honig als Süßungsmittel diente und Met eine wichtige Handelsware war, war es das Wachs, das am meisten einbrachte – etwa als Kerzenmaterial oder zur Behandlung von Holz und Leder. Große Wachsplatten wurden auf dem Nürnberger Hauptmarkt verkauft, der Bedarf war immens. Doch auch diese Zunft war nicht krisenfest: Der Met wurde vom Bier verdrängt, der Zucker ersetzte den Honig, Paraffin machte das Wachs obsolet. Epidemien, Klimakrisen und wirtschaftlicher Wandel führten letztlich zum Aussterben. Die Zeidlerei als Beruf war tot wie eine abgeschossene Tontaube.
In meinen Recherchen, die ich aus meinem Studio auf der Burg Giebichenstein so talentreich vorantrieb, stieß ich auf den Begriff der Klotzbeute. Spricht man bei einer Klotzbeute, fragte ich mich, quasi nur von diesem menschlich erzeugten Fragment eines Baumes, das aufgehangen wird? Oder ist auch die Höhle, die man irgendwie zum Beispiel in einen lebenden Baum schlägt, eine Klotzbeute? Waldleute, die über mehr Kompetenz verfügten als ich, belehrten mich. Klotzbeute war das nicht, sondern ein Zeidelbaum. Oder konkreter: eine Zeidelfichte, Zeideleiche. Eine Zeidelkiefer.
Die Zeidlerei, um darauf zurückzukommen, ist die ursprünglichste Form der Bienenhaltung in künstlich geschaffenen Baumhöhlen. Dabei werden in 1,2 bis 1,5 Meter langen, dicken Baumstammstücken Hohlräume von etwa 90 cm Höhe und 30 cm Tiefe geschlagen. Zusätzlich wird ein Flugloch mit einem Fluglochkeil eingearbeitet, das den Bienen einerseits den Zugang zu ihrer potenziellen Behausung ermöglicht und andererseits potenzielle Feinde fernhält.
Mit traditionellen Werkzeugen wie Dechseln und Stemmeisen wird der Stamm ausgehöhlt – lediglich der Einsatz von Kettensägen erleichtert heute das Vorgehen. In Zukunft werde ich, so dachte ich, neben einigen klassisch in Magazinbeuten gehaltenen Völkern, rund ein Dutzend Bienenvölker in Klotzbeuten betreuen.
Jeden Mittwoch gehe ich immer zu meinem Ansitz. Zuvor steht die Besichtigung der Wildkammer an. Direkt neben dem Betrieb eines befreundeten Jägers wird das erlegte Wild fachgerecht zerlegt, vakuumiert und eingefroren. Nach dem Schuss wird das Tier aufgebrochen, das Reh anschließend aufgehängt – es muss reifen.
Der Weg zum Ansitz führt mit einem alten G-Klasse-Geländewagen durch dichte Wiesen und Feldwege. Der kräftige Wuchs im Mai erschwerte die Suche nach einem geeigneten Platz. In einer Senke schließlich findet sich ein geeigneter Ort für zwei Personen – mit Ausblick auf Agrarfläche, Streuobstwiese und blühende Wiesen, mit dem Wald im Rücken. Das Revier ist geprägt von Reh- und Schwarzwild.
Einige recht hübsche, aber volkstümlich aussehende Frauen aus der Gegend stolpern in kleinen Gruppen durchs Gebüsch. Was wollten die hier? Geo-Caching? Husch, husch, weg, ich schieße gleich.
Meine Ausrüstung: ein jagdübliches Repetiergewehr mit Dreischussmagazin, Messer, Rucksack, Decke, Wärmebildgerät und Sitzkissen. Das Wärmebildgerät hilft, die Umgebung schnell und präzise abzusuchen – die Wärmesignatur verrät selbst verstecktes Wild. Um es noch einmal deutlich zu machen: Die Jagdpacht ist kein Selbstläufer. Gute Beziehungen zu Grundstücksbesitzern und zur Gemeinde sind entscheidend. Und auch juristisch trägt der Pächter Verantwortung: Für Wildschäden, beispielsweise durch Wildschweine im Maisfeld, kann er haftbar gemacht werden. Man kann da richtig Schaden anrichten, dann heißt es: zahlen.
Im Mai herrscht reger Betrieb im Revier. Es dürfen nur Schmaltiere, einjähriges Rehwild, und Böcke geschossen werden. Weibliche Rehe führen in dieser Zeit meist ein bis zwei Kitze. Das Alter des Wilds lässt sich unter anderem am späten Fellwechsel erkennen – vom Winter- zum Sommerfell. Schwarzwild und Füchse dürfen ganzjährig bejagt werden. Der Abend bringt Bewegung, die ich nicht erwartet hätte: Rehwild tritt aus dem Randbewuchs, junge Füchse zeigen sich neugierig, auch Alttiere und ein Steinkauz lassen sich beobachten. Ich lege Wert auf einen präzisen Schuss – bevorzugt in die Kammer, um lebenswichtige, blutführende Organe zu treffen. Alternativ ins zentrale Nervensystem. Ziel ist ein schnelles, schmerzfreies Ableben des Tieres. Welch schönes Spektakel! Gejagt wird etwa 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde danach. Doch an diesem Abend wird nichts geschossen. Heute läuft hier gar nichts. Nach gut zweieinhalb Stunden endet der Ansitz – ruhig, konzentriert, ohne Schuss – die Rückfahrt verläuft, wie die Jagd, ohne Vorkommnisse.
Es ist inakzeptabel, dass das Denken dem Geld gehorcht, aber verständlich, dass es aussetzt, wenn einen der Hunger übermannt. Ich wollte von der Kulinarik des Waldes kosten. Ich hatte von den Methodiken des Räucherns gehört, dem Einsatz von Asche, der komplexe geschmackliche Erfahrungen ermöglicht.
Als wir auf eine Lichtung einbogen, trafen wir wie bestellt auf einen Waldkoch. Er war zu meiner Überraschung gut gelaunt. Räuchern? Die Holzaromen, sagt er mir, die bringen meistens Bitterstoffe, Gerbstoffe, ganz klar. Man müsse sie aber dosiert einsetzen, damit sie nicht übersteuern. Zirbenholz, verriet er, war seine Geheimwaffe. Seine Zirbenholzinfusion reiche für drei Monate, er serviere sie als kleinen Shot, nach den Pralinen. Ich konnte auch anderen groben Versuchungen nicht widerstehen, zum Beispiel seinem Kiefernaufstrich mit frischen Nadeln. Sägemehl verwendete er für die Patisserie. Wir haben, sagte der Waldkoch stolz, zurzeit einen Raviolo mit Burratafülle, mit einem Heu-Espuma mit Milchhautchips, Bierhefe und Wildkräutern. Hier fand sich auf dem Teller alles – gedanklich – von der Kuh, ohne dass ich Fleisch esse: die Wildkräuter, das Heu, die Milch, aus der die Burrata gemacht wird.
Ich betrachtete sein Kalträuchergerät, eine Räucherpfeife. Dort wird der Garpunkt nicht beeinträchtigt, trotzdem bekommt man das Aroma super rüber und ganz oft ist eben danach der Teller stimmiger und auch spannender. Deswegen räuchert der Waldkoch auch hauptsächlich mit Laubbäumen. Buchenholz, manchmal Birke.
Wenn ein Maximum an Autorität erforderlich ist, widmet sich mein Waldkoch auch dem Wildfleischräuchern. Als Finish. Wenn er zum Beispiel einen Hirsch macht, geräucherten Hirsch, dann räuchert er das in der Räucherglosche direkt vor dem Gast. Also er bringt den Hirsch mit Räucherglosche raus, die wird dann vor dem Gast geöffnet.
Die Welt ist so beschaffen, dass sie ab und zu nach Neuem verlangt, und nach all meinen Recherchen, Gesprächen und Beobachtungen zur Verarbeitung, Haltbarmachung und Veredelung von Wildbret entstand die Idee eines Räucherofens, der sich gestalterisch zwischen traditionellen Funktionen und zeitgenössischer Formsprache verortet. Die Beobachtung, wie Rauch im Raum aufsteigt, Fleisch konserviert und gleichzeitig ein sinnliches Moment erzeugt, war Ausgangspunkt für meine gestalterische Auseinandersetzung.
Was ist der Kachelofen nicht alles: Versammlungsort, Wärmespender und narratives Objekt. Das war für mich ein atmosphärischer Anknüpfungspunkt – nicht zuletzt durch seine ornamentale Sprache, die Geschichten erzähl, Zugehörigkeit markiert und Räume strukturiert. Und die Räucheröfen der Gegenwart? Häufig waren das nur funktional umgenutzte Heizungskesselgeräte, die das Räuchern in den privaten oder semi-professionellen Bereich verbannen, verborgen im Hinterhof, Keller oder Schuppen. Ich wollte den unumstößlichen Beweis erbringen, dass es besser ging, den Räucherofen auf die Bühne zerren: ich wollte den Räucherprozess selbst in den Mittelpunkt rücken und gestalterisch sichtbar machen.
Erste Modelle orientierten sich formal an der bekannten Kastenform, verbanden diese aber mit historischen Proportionen und einer vertikalen Ausrichtung, wie sie auch in Kamin- oder Ofensituationen vorkommt. Im weiteren Prozess verlagerte sich der Fokus hin zu einer klareren Idee: Ein Glaskörper wurde integriert – als gestalterisches Element, aber auch als semitransparente Membran zwischen Innen und Außen. Inspiriert von sogenannten Galoschen aus der gehobenen Gastronomie, in denen einzelne Speisen unter Rauchglocken serviert werden, griff mein Entwurf das performative Moment auf: das Sichtbarmachen des Prozesses, die Aufladung des Vorgangs mit Sinnlichkeit und Wert. So entstand ein Objekt, das nicht nur dem Zweck der Haltbarmachung dient, sondern die Veredelung von Lebensmitteln – insbesondere von Wildbret – in Szene setzt. Der Räucherofen fungiert als Schnittstelle.
Malin Trepel
Wir besuchten den Salone de Mobile und waren gefrustet: Wohlhabende Unternehmen bewarben hübsche Möbel für Zielgruppen, die Lösungen für Besprechungs- und Wartezimmersituationen suchten. Was sollte das?
Das internationale Design-Proletariat hatte sich mal wieder in Mailand getroffen. Wie soll man von ihm in der Zukunft gesellschaftliche Neuerungen und Progressivität erwarten, die den Erfordernissen des Anthropozäns angemessene Schlagworte liefert? Wir musste selbst ran.
Um ein Designstudio zu gründen, braucht es eine Vision und einen Namen. Vom Ausgangsnamen Cambio (lat. Wechsel), zu dem uns formafantasma inspiriert hatte, über nemus (lat. Hain) und mulm (einem deutschen Begriff, der eine humusartige
Schicht im Wald, Aquarien und in Höhlen beschreibt) landeten wir bei unserem finalen
Namen: studio plenta. Der Name verweist auf den Plenterwald. Dies ist ein naturnah bewirtschafteter Dauerwald, in dem Bäume unterschiedlicher Altersklassen und Arten auf engem Raum koexistieren. Unser Studio verstand sich als vielstimmige Plattform, die den Wald als gestalterischer Partner neu denkt.
Der Wald sollte unser verbindendes Band sein. Angestoßen durch einen Text der Kuratorin Laura Leonelli fiel mir auf, dass in meiner Vorstellung nur bestimmte Personengruppen im Wald aktiv sind: Der Förster, der Jäger oder Holzfäller – stilisierte Charaktere, die mit Dackel, Flinte und Axt durch den Wald streifen. Ihre Gemeinsamkeit: Das waren alles Männer! Die einzigen weiblichen oder queeren Figuren, die mir einfielen, waren Fabelwesen wie die Hexe oder Feen.
Also war die Sache klar: ich musste mich auf die Suche nach feministischen Perspektiven machen. Gibt es einen feministischen Umgang mit Wald?
Im Zuge meiner Recherche stieß ich auf die sog. „Kulturfrauen“: die Trümmerfrauen des Waldes, die vor allem zwischen 1945 und 1948 aktiv waren. Sie forsteten etwa 140.000 Hektar der 200.000 fußballfeldgroßen Kahlflächen auf, die durch Reparationshiebe und illegalen Waldfällungen nach dem zweiten Weltkrieg entstanden sind. Für die sehr mühsame Arbeit bekamen sie 50 Pfennig Stundenlohn. Die 50-Pfennig Münze war später daher der logische Ort, der an die Trümmerfrauen erinnern sollte.
Wenn Frauen heute in der Waldwirtschaft arbeiten, ist nicht alles feindlich. Manche Chefs nehmen Rücksicht, besorgen einen leichteren Hammer und eine leichtere Axt zum Keilen. Viele Griffe von Sägen oder ein Hammerstiel sind einfach zu dick für Frauenhände. Woran Männer aber wahrscheinlich nie denken: Es gibt keine spezielle Frauenkleidung für das Arbeiten im Wald. Bei T-Shirts oder Jacken solls egal sein – XS passt meistens. Aber bei Schnittschutzhosen beginnt das Problem. Die sind extrem wichtig, wenn man mit der Säge arbeitet. Männerschnitte passen einfach nicht. Natürlich schützt Hose genauso gut, aber das Tragegefühl ist desolat und Bewegungen sind eingeschränkt. Ohne tiefgründige Überlegungen kommt man schnell zur Einsicht, dass vernünftige Frauenarbeitskleidung in die Waldarbeit Einzug halten muss. Wie gut, dass es dafür unser spezialisiertes Designstudio Plenta gab.
Bei meinen zahlreichen Gesprächen stellte sich heraus, dass die Entwicklung einer funktionalen Hose im Rahmen der Berufsbekleidung für den forstlichen Außendienst zu den drängendsten Anliegen gehörte. Eine neue Hose musste her!
Nach wochenlangen Designanstrengungen war sie fertig. Mein Hosenentwurf sollte Bekanntes mit Ungewohntem verknüpfen: asymmetrisch platzierte Reflektoren, gestickte Symbole und typografische Details transportieren inhaltliche Bezüge und forderten zur Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen in der Forstwirtschaft auf. Die Hose blieb praktisch einsetzbar, wurde von mir jedoch bewusst schwungvoll, dynamisch und visuell auffällig gestaltet – eine Entscheidung, die die notwendige Bewegung im Diskurs um Geschlechterrollen und Körpernormen auch formal aufgreift. Der Fokus liegt nicht auf der Optimierung des Schnittschutzes, sondern auf einem Schnitt, der von verschiedenen Körpern sicher getragen werden kann. Bestehende Schutzkleidung orientiert sich an normierten Maßen und schließt dadurch viele Personen strukturell aus. Mein Ziel war es nun, das Angebot um einen Schnitt zu erweitern, der zwei Größen abdeckt. Eine universelle Passform ließ sich aus sicherheitstechnischen Gründen und innerhalb des Zeitrahmens nicht realisieren. Da Schnittschutz nur bei enger Passform zuverlässig wirkt, birgt zu viel Spielraum das Risiko sogenannter Hosenwickler.
Die Brillanz der Hose zeigt sich an Details. Gestalterisch wurden klassisch weiblich konnotierte Elemente aufgenommen und transformiert: verdeckt eingearbeitete Hosentaschen, die durch neonfarbene Patten mit Reflektoren betont werden und den Schnitt funktional wie formal strukturieren. Auch der Hosenladen wurde bewusst linksseitig geöffnet – ein subtiler Verweis auf geschlechtliche Normierung in der Bekleidung. Ausgehend von einem Grundschnitt wurde der Entwurf an ein Modell angepasst, in iterativen Schleifen mit mehreren Nesselprototypen weiterentwickelt und schließlich im Originalmaterial umgesetzt.
Noch habe ich kein Label im Berufsbekleidungssektor gefunden, das die Hose in ihre Kollektionen aufnehmen will. Ist nicht so easy in der Branche. Ich habe mal vor Jahren die Firma Stihl angeschrieben und gefragt, ob sie nicht beabsichtigen, eventuell mal Motorsägen für Frauen zu entwickeln. Die mehlbetauten Vorstände von Siehl, die gerne in ihrer Werbung (insbesondere im Hobby-Bereich) mit leicht bekleideten Frauen werben, haben sich das alles geduldig angehört, um die Vorschläge anschließend wieder sofort zu vergessen, jedenfalls wird nichts umgesetzt. Derzeit rennen feministische Perspektiven in der Waldwirtschaft noch gegen eine Wand. Ich will das für den allgemeinen Außendienst aber nicht überdramatisieren.
Studio Plenta ist ein experimentelles Designstudio, das aus dem Semesterprojekt Studio Cambio – Wald und Designstrategien an der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale hervorging.
Fünf Studierende des Studiengangs Industriedesign, Spiel- und Lerndesign und Industrial Design entwickelten Projekte, die sich mit nachhaltigem Waldtourismus, feministischen Perspektiven in der Forstarbeit, Waldkulinarik und Care-Arbeit für Waldökosysteme beschäftigen.
Studio Plenta sind Camille von Gerkan, Max Koch, Frederick Ostertag, Raphael Rustige und Malin Trepel.