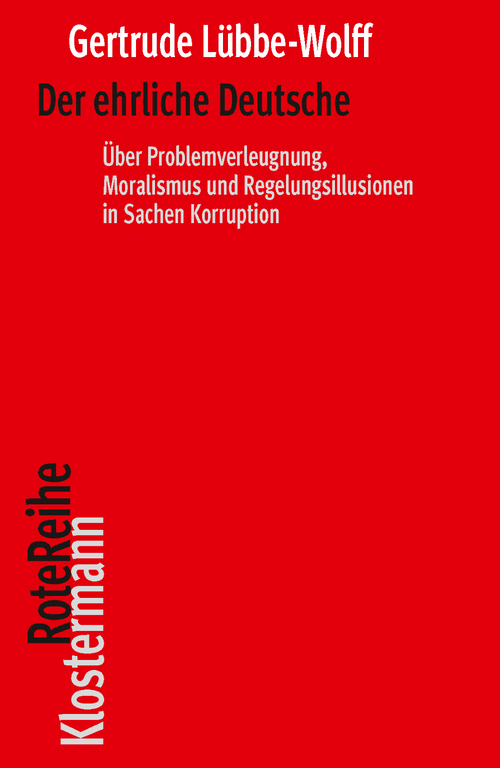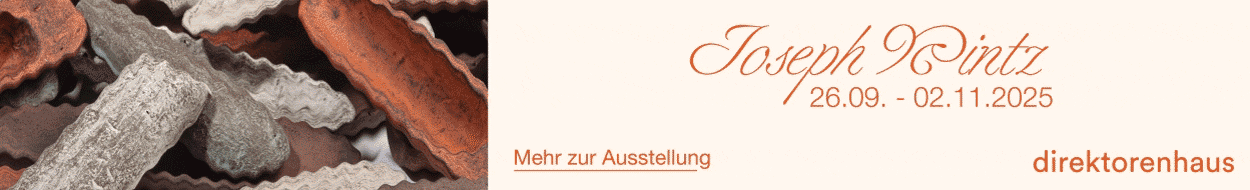R: Frau Lübbe-Wolff, warum ist Korruption schädlich?
Gertrude Lübbe-Wolff: Im politischen Bereich verzerrt sie den politischen Wettbewerb und damit die demokratische Willensbildung. In der Wirtschaft verzerrt sie den wirtschaftlichen Wettbewerb. Beides führt zu teuren Fehlentscheidungen. Unter anderem wird sehr viel Geld ausgegeben, wo es politisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
Das Phänomen Korruption vermuten wir vor allem in Ländern, in denen Bananen wachsen, oder in nepotistischen Kleptokratien wie Tadschikistan. In Ihrem Buch, „Der ehrliche Deutsche“, lenken Sie den Blick nun auch auf die deutsche Realität.
Korruption ist überall schädlich, wo sie stattfindet, ob in Deutschland oder anderswo. Vom Straßenbau bis zu Coronaschutzmasken werden Güter und Leistungen viel teurer beschafft, als nötig wäre. Posten kriegen nicht die dafür Geeigneten, sondern Familienmitglieder, Freunde, Mafiakollegen. Die Folgen sieht man am deutlichsten in den vielen Staaten der Welt, in denen ein hohes Maß an Korruption herrscht. Die Demokratie funktioniert da nicht, selbst wenn die Staatsform auf dem Papier demokratisch ist. Der Staat funktioniert im Interesse einer kleinen Schicht, die sich bereichert, und die Wirtschaft kommt nicht auf die Füße.
Wie steht Deutschland in den internationalen Rankings, die die Korruption im öffentlichen Sektor verschiedener Länder bewerten, da?
Als das Buch zum Druck gegeben wurde, stand Deutschland im CPI, dem Index von Transparency International für die wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor, mit 78 von 100 möglichen Punkten auf Rangplatz neun der am wenigsten korrupten von insgesamt 180 Ländern. Von denen sind die weitaus meisten leider sehr hoch korruptionsbelastet. Trotzdem: Neunter Platz, das ist kein schlechter Wert im meistgenutzten Index. Aber wir verbessern uns seit längerem nicht mehr. Zugleich gibt es zahlreiche Risiken, die für die Zukunft eher eine Verschlechterung befürchten lassen, und tatsächlich sind wir im inzwischen erschienenen neuesten CPI von 78 auf 75 Punkte abgesackt und stehen nur noch auf Rang 15.
Diese Platzierungen sind nicht ganz das, was dem deutschen Selbstwertgefühl der Vorbildlichkeit in Sachen Korrektheit entspricht. Welche Risiken sehen Sie, dass sich der Abwärtstrend verstetigt?
Ich sehe die Gefahr, dass wir auf zunehmende Korruptionsrisiken nicht ausreichend reagieren. Krieg und sonstige Krisen aller Art sind immer mit massiv erhöhten Korruptionsrisiken verbunden, und mit Krisen haben wir zunehmend zu tun. Die organisierte Kriminalität ist ein anderer Risikofaktor, gegen den wir nicht gut gewappnet sind. Auch andere Aspekte der Internationalisierung spielen eine tendenziell problemverschärfende Rolle. Hinzu kommt, dass Entscheidungsvorgänge heute viel komplexer und deshalb schwerer überprüfbar und gegen Korruption abschirmbar sind als früher. Auch wachsende wirtschaftliche Ungleichheit geht mit zusätzlichen Korruptionsrisiken einher.
Unterschätzen wir in Deutschland die Gefahr der Korruption?
Ja. Zwar glaubt inzwischen wohl kaum noch jemand, wir seien als Deutsche quasi von Natur aus immun gegen Korruption. Aber Viele machen sich nicht klar, dass man sich auf einem einmal erreichten Niveau der Integrität, oder Rechtschaffenheit, wenn man es mit einem etwas altmodischen, aber ganz schönen deutschen Wort ausdrücken will, nicht einfach ausruhen kann.
Rechtschaffenheit ist ein schönes Wort. Wir verbinden es mit moralischer Integrität, mit der Vorstellung, nach hohen ethischen Standards zu leben. Wir haben ein klares, positives Bild im Kopf. Aber neben der klassischen Bestechung sieht man sich mit einer Vielzahl von Spielarten konfrontiert: dem selbstbedienerischen Ausplündern öffentlicher Kassen, klientilistischen Praktiken, parteipolitischer Patronage, Begünstigung von Gruppen usw. Was ist noch erlaubt, was nicht? Abgrenzungen fallen da schwer.
Die sog. TI-Definition (von Transparency International) – Korruption als Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil – ist zwar, wie andere kursierende Definitionen auch, in Randbereichen vage. Aber als Ausgangspunkt ist sie sehr gut brauchbar. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den Grund der Missbilligung von Korruption. Und sie ist nicht zu eng gefasst. Erstens erfasst sie nicht nur politische Korruption, also den Missbrauch von politischer Macht und Amtsbefugnissen. Es gibt Korruption auch in der Wirtschaft, und sie richtet auch da großen Schaden an. Ein Korruptionsbegriff, unter den zum Beispiel Bestechung in der Wirtschaft, etwa um Aufträge zu erhalten, nicht fiele, wäre nicht sinnvoll. Außerdem erfasst die TI-Definition nicht nur die klassischen Fälle der Bestechung und Vorteilsannahme.
Bestechung lässt sich für Laien noch relativ einfach nachvollziehen.
Bestechung ist sozusagen der Paradefall der Korruption. Da ist immer ein Bestechender und ein Bestochener beteiligt. Aber als korrupt kann man auch Politiker oder Geschäftsleute bezeichnen, die zum Beispiel Gelder aus den Kassen oder Konten unterschlagen, über die sie im öffentlichen Interesse oder im Interesse des Unternehmens, bei dem sie beschäftigt sind, verfügen können. Auch da liegt ein Missbrauch von Macht, von Verfügungsbefugnissen vor, die einem anvertraut sind – aber eben anvertraut im Interesse des Gemeinwohls oder im Interesse des Unternehmens, für das man arbeitet, nicht im Interesse desjenigen, der da Verfügungsmacht hat.
Haben wir in Deutschland nicht vor allem Randbereiche der „legalen“ oder „institutionellen Korruption“: Fälle, bei denen sich Interessengruppen durch Einfluss, Absprachen und Deals Vorteile verschaffen?
Wenn ein Politiker oder ein Amtsträger Geld für eine bestimmte Gegenleistung erhält, zum Beispiel für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten als Abgeordneter oder für eine bestimmte Auftragsvergabe als behördlicher Entscheider, dann handelt es sich um klassische Fälle strafbarer Bestechung oder Vorteilsnahme. Aber es gab und gibt zum Teil noch immer Bereiche, in denen Verhaltensweisen, die man mit guten Gründen als korrupt ansehen kann, nicht klar als rechtwidrig ausgezeichnet sind. Bis vor kurzem war es zum Beispiel nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht strafbar, wenn jemand sich als Abgeordneter gegen Provision gegenüber dem Gesundheitsministerium für die Beschaffung von Coronaschutzmasken einer bestimmten Firma einsetzte. Das lag daran, dass der Tatbestand der Abgeordnetenbestechung nur Handlungen „bei der Wahrnehmung seines Mandates“ erfasst (§ 108e StGB), und dass darunter nur Handlungen im Parlament und seinen Ausschüssen verstanden werden. Diese Strafbarkeitslücke ist inzwischen geschlossen worden durch einen neuen Straftatbestand der „Unzulässigen Interessenwahrnehmung“. Aber es gibt andere Bereiche, wo das Recht gegen verzerrende Einflüsse noch immer zu wenig unternimmt.
Der Gesetzgeber reagierte erstaunlich zügig auf die sog. Maskenaffäre. Dennoch bleibt es aus der Sicht der Zivilgesellschaft schwer, innerhalb der Spielräume des möglicherweise Erlaubten die Grenzen zur Korruption präzise zu ziehen.
Die entscheidende Frage ist, was erlaubt sein sollte und was nicht. Abgrenzungsprobleme gibt es da vor allem bei der Entgegennahme von Vorteilen, für die keine konkrete Gegenleistung verlangt oder versprochen wird. Nehmen Sie zum Beispiel Parteispenden und Spenden an Abgeordnete. Da haben wir ein Transparenzgebot. Spenden ab einer bestimmten Höhe – bei Parteien über 35.000 €, beim einzelnen Bundestagsabgeordneten über 3000 € – müssen mit dem Namen des Spenders veröffentlicht werden. Außerdem gibt es Grenzen für die steuerliche Absatzbarkeit – nur bei Parteispenden, Spenden an Abgeordnete sind von vornherein nicht steuerlich absetzbar. Die Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit von Parteisenden ist gesetzlich geregelt und wird vom Bundesverfassungsgericht verlangt, damit sich nicht ein politischer Einfluss besonders wohlhabender Spender durch staatliche Unterstützung noch vergrößert. Indirekt ist damit anerkannt, was ja auch ohnehin offensichtlich ist: Geldspenden an politische Organisationen und Akteure verschaffen Einfluss. Dann sollte es aber eigentlich auch eine Obergrenze für zulässige Spenden geben. Die gibt es bislang bei uns nicht. Bisher liegen die Parteispenden bei uns meist noch vergleichsweise niedrig, meist maximal bei einigen hunderttausend Euro. Das fängt aber gerade an, sich zu ändern. In diesem Jahr hat es schon mehrere Spenden in Millionenhöhe oder knapp darunter gegeben. Da sind wir nicht mehr so weit wie früher von Verhältnissen wie in den USA entfernt, wo die Abhängigkeit der Politik von privaten Geldgebern ein besorgniserregendes Ausmaß hat. Das tut der Demokratie nicht gut.
Die AfD erhielt im Jahr 2025 Großspenden mit einer Gesamtsumme von rund fünf Millionen Euro und damit in der bisherigen Gesamtsumme die höchsten Spendenzuwendungen. Ist es eine reale Gefahr, dass sich einzelne Millionäre auch in Deutschland einen Kanzler oder eine Kanzlerin kaufen könnten?
Bei großen Parteispenden geht es typischerweise nicht um ein schlichtes „Kaufen“ nach dem Motto „Für soundsoviel Geld hätte ich gern die und die Entscheidung“. Das wäre ja auch eindeutig strafbar. Aber auf subtilere Weise wird natürlich trotzdem Einfluss ausgeübt. Wenn zum Beispiel Automobilkonzerne große Summen spenden, dann weiß man auch ohne dass dafür bestimmte politische Zusagen gemacht werden, dass solchen Spendern ein Tempolimit keine Freude bereitet. Großspender, die ihr Geld mit Social Media oder mit KI verdienen, haben keinen Spaß an strengen Vorschriften zum Jugendschutz oder zum Urheberrechtsschutz der verwendeten Daten. Wer da weiter Geld bekommen möchte, weiß auch ohne gekauft zu sein, was für den weiteren Empfang solcher Spenden förderlich ist und was nicht. Das hat überzeugungsbildende Wirkung, da darf man sich nichts vormachen. Es wäre nicht richtig, hier individuellen Akteuren Korruption vorzuwerfen, wenn sie erlaubte Spenden annehmen. Es muss aber eben klare Regeln geben, meiner Meinung nach unter anderem eine Obergrenze für Parteispenden.
Muss bei Korruption immer ein Geldfluss nachgewiesen werden? Die Frage richtet sich auf Phänomene der strukturellen Korruption: also solche Fälle, die nicht als Gelegenheitstat entstehen, sondern denen langfristige, gewachsene Strukturen zugrunde liegen. Zu denken wäre z.B. an eine Lobbygruppe im Immobilienbereich, deren Ziel es ist, durch außerordentlich gute „Kooperation“ mit einem Amtsträger über einen längeren Zeitraum an Landesimmobilien zu kommen, während politisch dafür gesorgt wird, dass transparente Ausschreibungen verhindert werden und die Liegenschaft so unter Wert vergeben wird. Wann wäre das Korruption?
Wenn zugunsten irgendwelcher Spezis die Regeln für Ausschreibungen nicht eingehalten werden, kann man von Korruption sprechen. Um Bestechung oder Vorteilsannahme handelt es sich aber nicht, wenn im Austausch dafür keine Vorteile zugewendet werden. Strafrechtlich läge aber Untreue vor, weil der Amtsträger, der so handelt, damit seine Befugnis, über Vermögensgegenstände des Landes zu verfügen, missbraucht und dem Land damit einen erheblichen Nachteil zufügt. Auch für das Vorliegen von Bestechung oder Vorteilsannahme käme es übrigens nicht auf Geldflüsse an. Es genügen auch Vorteilszuwendungen anderer Art, etwa wenn für eine bestimmte Amtshandlung nicht Geld gezahlt oder versprochen wird, sondern zum Beispiel ein Job für einen Verwandten.
Die Maskenaffäre hat gezeigt, wie sich Recht auch im Hinblick auf Korruptionsprävention weiterentwickeln kann. Aber die Frage bleibt doch: wer kann die weitere notwendige Klärungsarbeit leisten?
Verbindliche Abgrenzungen sind Sache des Gesetzgebers. Aber zunächst einmal braucht es eine intensivere öffentliche Diskussion über diese Fragen.
Eine gesellschaftliche Diskussion gibt es doch. Die Initiative zum neuen geplanten Transparenzgesetz etwa wurde in der Zivilgesellschaft diskutiert und das Bündnis, das das neue Transparenzgesetz unterstützte, stand auf breiten Beinen (Frag den Staat, TI, LobbyControl, Netzwerk Recherche, u.a.). Am Ende hatten die NGOs sogar einen konkreten Gesetzesentwurf ausgearbeitet.
Zu den Fragen der Gesetzgebung, die im Hinblick auf Korruptionsvermeidung wichtig sind, gibt es tatsächlich nicht wenig Diskussion, aber die reicht zu oft nicht weit über die zivilgesellschaftlichen Organisationen hinaus, die sich speziell die Korruptionsbekämpfung oder die Förderung der Integrität im politischen Betrieb zur Aufgabe gemacht haben. Und wo solche Diskussionen auch die Politik erreicht und beschäftigt haben, verläuft das dann immer noch zu leicht im Sande. Im Koalitionsvertrag für die zurückliegende Wahlperiode zum Beispiel war ein Transparenzgesetz verabredet, das die Transparenz in Politik und Verwaltung auf Bundesebene hätte verbessern sollen. Dieser Plan ist aber nicht einmal bis zu einem ins Parlament eingebrachten Gesetzentwurf gediehen. Im Koalitionsvertrag für die laufende Wahlperiode kommt das Wort Transparenz zwar des Öfteren vor, und es ist davon die Rede, dass das bisherige Informationsfreiheitsgesetz mit einem Mehrwert für die Bürger – und, wer hätte das gedacht, auch für die Bürgerinnen – reformiert werden soll, aber der Plan eines Transparenzgesetzes, das diesen Namen trägt und ihn auch verdient, ist offenbar beerdigt.
Was bedeuten würde, dass eine Rechtsfortentwicklung auf lange Sicht nicht zu erwarten ist. Was also dann? Wer kann neue Wege und Präzisierungen vorantreiben, wenn der Gesetzgeber keinen neuen Anlauf nimmt? Erschwerend kommt für die Korruptionsprävention in Deutschland hinzu, dass sie „keine zentrale Telefonnummer“ hat, wie Peter Sloterdijk sagen würde.
Die wichtigsten Akteure im staatlichen Sektor sind die Gesetzgeber in Bund und Ländern. Unser föderales System bedingt, dass es da nicht die eine Zentrale gibt. Im Rahmen der Gesetze sind in Bund und Ländern auch die Verwaltungen gefragt, einschließlich der kommunalen. Bei den Staatsanwaltschaften sollte es spezialisierte Einheiten mit entsprechender Fachkompetenz geben, auch für das Aufspüren der Geldflüsse, die mit Korruption zusammenhängen. Deutschland gilt international als Geldwäscheparadies. Das muss sich unbedingt ändern. Ich glaube übrigens nicht, dass eine Rechtsfortentwicklung nicht zu erwarten ist. In den zurückliegenden Jahren hat sich da durchaus einiges getan, das habe ich in meinem Buch auch beschrieben. Aber das reicht eben noch nicht. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Deshalb arbeiten viele andere Menschen und Organisationen für weitere Verbesserungen, und diese Arbeit ist nicht aussichtslos. Deshalb glauben wir ja auch, dass ein Interview wie dieses nicht völlig sinnlos ist.
Das Problembewusstsein ist in Deutschland unterentwickelt, sagen Sie, und zwar nicht nur in Politik und Wirtschaft, sondern auch bei denen, die als die „Guten“ gelten, die nicht korrupt sind, sondern der Korruption gerade auch entgegenwirken – also bei den Medien, den NGOs, der Justiz. Sind die, die selbst eine Wächterfunktion haben sollten, zu passiv?
Da kann man nicht verallgemeinern, aber teilweise ist wirklich noch viel Luft nach oben, sowohl was die Gesetzgebung als auch was die Selbstkontrolle angeht. Beispiel Justiz: Die ist bei uns nach allem, was man weiß, hochgradig integer. Aber einzelne Fälle hat es auch da schon gegeben, ich erinnere nur an den Fall des Frankfurter Oberstaatsanwalts, der für die Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen zuständig, tatsächlich aber selbst korrupt war und inzwischen verurteilt ist. Der Fall zeigt sehr schön, wie gefährlich es ist, wenn Institutionen sich auf dem Gefühl ausruhen, sie seien doch die Guten, statt auch gegen die eigene Fehlbarkeit wachsam zu sein.
Ist es nicht so, dass unsere Strukturen einfach zu groß sind? Die Länder, die im CPI-Index vorn liegen, sind nicht umsonst Länder mit 5 bis 8 Mio. Einwohnern: Dänemark, Finnland, Singapur, Luxemburg, Norwegen, Schweiz. Ist es in Deutschland illusorisch, Korruptionsprävention auf diesem Niveau zu etablieren?
Nein. Größe ist nicht der entscheidende Punkt. Sehr kleine Strukturen sind in gewisser Weise sogar besonders anfällig, weil da jeder jeden kennt und alle Verhältnisse dann oft stärker, als für die Vermeidung von Korruption gut ist, von persönlichen Beziehungen geprägt sind. Andererseits entsteht in einem kleinen Land leichter Vertrauen in die demokratischen Institutionen, weil rein zahlenmäßig jeder Einzelne einen größeren Anteil an der demokratischen Willensbildung hat. In den skandinavischen Staaten ist es vor allem das sehr hohe Transparenzniveau, das der Korruption entgegenwirkt, und in der Schweiz die direkte Demokratie.
Zu den Vorkehrungen: Wichtig ist, sagen Sie, eine glaubwürdige Politik der Sanktionierung von Verstößen, die auch damit zusammenhängt, dass eine höhere Entdeckungswahrscheinlichkeit durch geeignete Maßnahmen gefördert wird. Dies gelänge vor allem durch die Herstellung ausreichender Transparenz. Gerade in Deutschland existieren aber, sagen Sie, große Vorbehalte gegen Transparenz. Die Deutschen seien transparenzavers.
Auch eine Sanktionskultur, die dafür sorgt, dass Regelverstöße konsequent geahndet werden, ist tatsächlich wichtig. Das ist möglicherweise das, womit Singapur punkten kann. Das soll aber jetzt keine Werbung für ein so rigoroses Strafrecht sein, wie man es in Singapur hat. Strafrecht sollte schnell und konsequent funktionieren, dann kommt man auch mit vergleichsweise milden Sanktionen aus. Mehr Transparenz befürworte ich vor allem, weil sie auch präventiv gegen Korruption wirkt. Korruption entwickelt sich im Dunklen. Im Licht, unter Bedingungen der Transparenz, gedeiht sie nicht so gut.
Warum hat man in Deutschland so viel mehr Vorbehalte gegen Transparenz als zum Beispiel in Schweden, das besonders bekannt ist für seine Transparenzkultur?
Das lässt sich auch historisch erklären. Die schwedische Transparenzkultur geht auf das 18. Jh. zurück. In Deutschland und überhaupt in West- und Zentraleuropa wirkt dagegen bis heute die historische Arkantradition nach. Traditionen und historische Bedingungen spielen auch sonst eine wichtige, weit über die historischen Umstände hinauswirkende Rolle. Regionen mit einer langen Geschichte von Feudalismus und Leibeigenschaft z.B. sind bis heute korrupter als Regionen mit freien Bauern oder Regionen, in denen eine freie städtische Bürgergesellschaft dominierte.
Gleichwohl müssten wir, sagen Sie in Ihrem Buch, die Potentiale der Transparenz heute mehr nutzen. Denken Sie, dass sich in der aktuellen politischen Konstellation hierzulande etwas ändern wird?
Mehr Transparenz wird es unter der gegenwärtigen Koalition vermutlich nur punktuell geben, aber immerhin. Dafür ist aber zum Beispiel, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, ein entschiedeneres Vorgehen gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität wahrscheinlich.
Wagen wir einen generelleren Ausblick: Welche Chancen auf Veränderung sehen Sie insgesamt im Hinblick auf ein umfassendes institutionelles Design, das mehr Elemente wirksamer Korruptionsvorbeugung berücksichtigt?
In einer Demokratie sitzt die Macht, Veränderungen durchzusetzen, zum Glück nicht bei einzelnen Personen oder an einer einzelnen zentralen Stelle. Vernünftige und notwendige Veränderungen im institutionellen Design kommen nur zustande, wenn sich ein öffentliches Bewusstsein für die Notwendigkeit gebildet hat. Und umgekehrt wird das jeweilige Bewusstsein ganz wesentlich vom institutionellen Design geprägt. Transparenz zum Beispiel verringert die Gelegenheiten zur Korruption und trägt zur Ehrlichkeit bei. Aber damit eine Gesellschaft bereit ist und von der Politik verlangt, sie herzustellen, braucht man schon ein Bewusstsein für ihre Vorteile und für die Nachteile und Risiken, wenn sie fehlt. Weil Meinungen und Mentalitäten auf der einen Seite und das institutionelle Design, die geltenden Regeln, auf der anderen Seite, wechselseitig voneinander abhängig sind, braucht nachhaltiger Fortschritt zu einer besseren Ordnung und zu dem besseren Bürgersinn, zu der höheren Integrität, die damit einhergehen, Zeit und Arbeit. Rudolf von Jhering, ein berühmter Jurist, hat im neunzehnten Jahrhundert von dem „Kampf ums Recht“ gesprochen, der nie aufhören darf, wenn sich nicht das Unrecht breitmachen soll. Das gilt auch für das Thema Korruption.