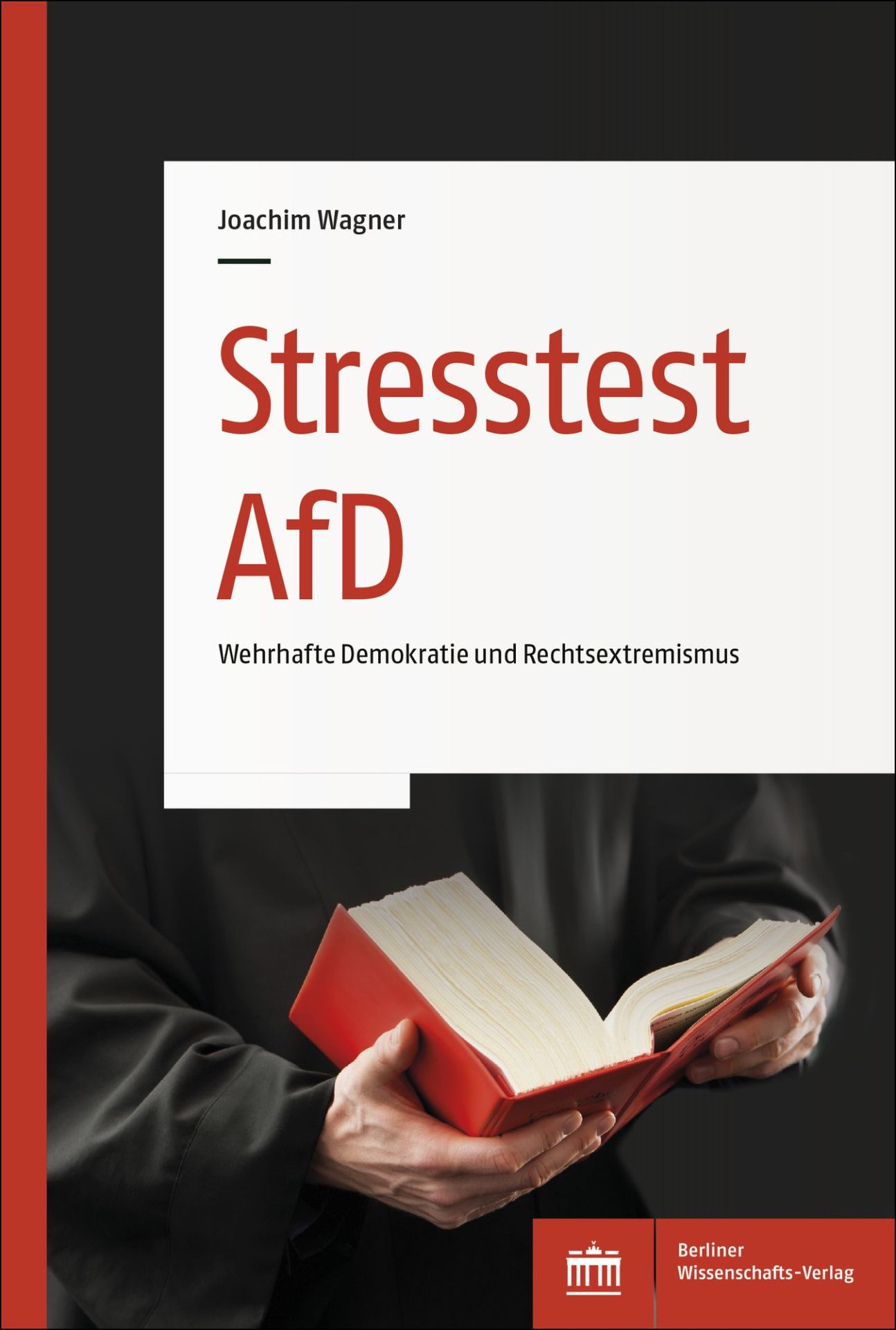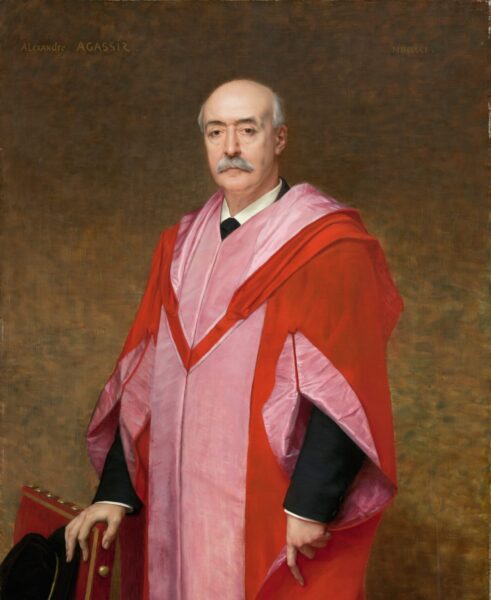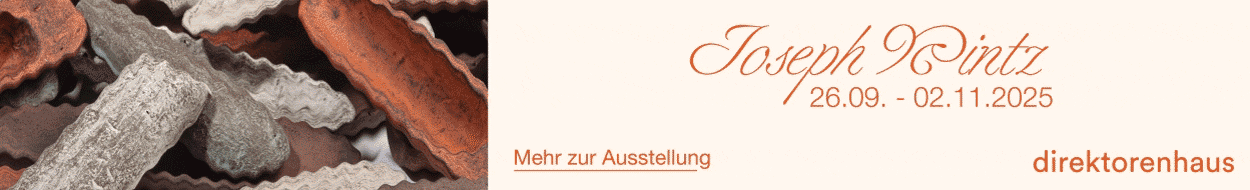Herr Wagner, ein Namensvetter von Ihnen, der Historiker Jens-Christian Wagner, leitet die Gedenkstätte KZ Buchenwald. Er wurde unlängst gefragt, ob der sich der Kampagne zum AFD-Verbot anschließen würde. Der Gedenkstättenleiter überlegte lange, sagte dann aber: ja. Hätte sich, so seine Überzeugung, die Weimarer Republik wehrhafter gezeigt, hätte man die NSDAP 1929 oder 1930 verboten, wäre der Menschheit viel erspart geblieben. Verschlafen wir den Ernstfall?
JOACHIM WAGNER Ich wäre sehr vorsichtig mit historischen Parallelen zur Weimarer Republik. Solche Vergleiche hinken meist. Ich möchte mich lieber auf die aktuelle Situation beziehen. Und da ist es tatsächlich erschreckend, in welchem Umfang die AfD in den letzten Jahren in Umfragen zugelegt und bei Wahlen Stimmen dazu gewonnen hat. Bei der Bundestagswahl 2025 ist sie in allen fünf Ostbundesländern stärkste Partei geworden. Das sind Alarmzeichen. Trotzdem bin ich strikt gegen eine AfD-Verbotsverfahren, aus politischen wie rechtlichen Gründen. Wir können nicht fast einem Viertel aller Wähler das Recht absprechen, in Parlamenten vertreten zu sein. Und die rechtlichen Risiken eines Scheiterns vor dem Bundesverfassungsgericht bleiben unkalkulierbar.
Dennoch hat die demokratische Mitte noch genug Stimmen, um Mehrheiten zu bilden.
Dass die Parteien der demokratischen Mitte noch die Mehrheit haben, reicht schon jetzt nicht. Notwendig ist eine handlungsfähige Mehrheit der demokratischen Parteien. Und daran hat es in den letzten Jahren leider gehapert. Man kann der AfD nur dann das Wasser abgraben, wenn man besser regiert als bisher. Die Ampelregierung ist mehr durch Streit als durch politische Erfolge aufgefallen. Und der Auftakt der schwarz-roten Koalition gibt wenig Hoffnung auf Besserung – zumindest innenpolitisch. Das gilt in erster Linie für die weiter ungelöste Migrationsfrage, dem Gewinnerthema Nummer Eins der Rechtspopulisten. Ohne entscheidende Erfolge an dieser Front ist die AfD politisch nicht wirkungsvoll zu bekämpfen. Allgemeiner formuliert: Die Parteien der demokratischen Mitte haben aus meiner Sicht noch nicht angefangen, sich mit der AfD intensiv politisch auseinanderzusetzen.
Die Bundesrepublik steht vor dem Stresstest, sagen Sie in Ihrem neuen Buch: Die AfD ist die erste Rechtsaußenpartei, die das Prinzip der wehrhaften Demokratie ernsthaft herausfordert. Haben unsere rechtsstaatlichen Mittel bisher versagt?
Nein, die rechtsstaatlichen Mittel haben sich bewährt. Die Justiz, herausgefordert durch den Vielkläger AfD, hat den Stresstest im Großen und Ganzen bestanden. Das gilt insbesondere für ihre Rechtsprechung zum Verfassungsschutz als Dienstleister der wehrhaften Demokratie. Hier haben die Gerichte sie die Einstufungen der AfD und ihre Teilorganisationen „Junge Alternative“ und den „Flügel“ als „Verdachtsfall“ und „gesichert rechtsextremistisch“ gebilligt. Korrigiert hat die Rechtsprechung die Verfassungsschutzämter nur in Randbereichen, bei der offensiven Öffentlichkeitsarbeit einiger Landesämter für Verfassungsschutz und nicht ausreichend belegten Mitgliederzahlen des „Flügel“ in den jährlichen Verfassungsschutzberichten.
Dabei hat es die AfD der Justiz nicht leicht gemacht: Sie überschwemmte die deutschen Gerichte mit Klagewellen. Sie kritisieren nicht nur die Zahl der Klagen, sondern befürchten, dass durch sie auch eine Verrechtlichung demokratischer Prozesse entsteht. Was meinen Sie damit?
Der Idealfall ist ja, dass die Parlamente in der Demokratie Entscheidungen so treffen, dass auch die Oppositionsparteien die Entscheidungen der Mehrheitsparteien akzeptieren. Das ist der Kern des demokratischen Mehrheitsprinzips. Was wir bei der AfD zum ersten Mal in der deutschen Geschichte erleben ist, dass eine Partei sich mit parlamentarischen Niederlagen häufig nicht abfindet und dagegen klagt. Dadurch werden demokratische Prozesse verrechtlicht. In diesen Fällen hat nicht mehr das Parlament das letzte Wort, sondern die Justiz. Hier beobachten wir eine Machtverschiebung zwischen zwei Verfassungsorganen zulasten der Parlamente, den Herzen der Demokratie. Über Schlüsselfragen von Staat und Gesellschaft entscheidet zunehmend nicht mehr das vom Volk gewählte Parlament, sondern die Justiz. Die Aufwertung der Justiz geht mit einer Abwertung des Parlaments einher.
Kann man denn wirklich von einer Klagewut der AfD sprechen?
Ich denke schon. Natürlich hat eine Partei das legitime Recht zu klagen. Sie kann den Rechtsweg beschreiten. Die AfD hat sich aber zu einem Serienkläger entwickelt. Umfragen bei Verwaltungs- und Verfassungsgerichten sprechen eine deutliche Sprache: 51 abgeschlossene und anhängige Verfahren beim Bundesverfassungsgericht! Von den Mitte-Parteien waren Ende Oktober 2024 gerade mal vier Verfahren dort anhängig. Ende Oktober 2024 waren bei den sechzehn Landesverfassungsgerichten, den kleinen Brüdern des Bundesverfassungsgerichts auf Landesebene, 151 Verfahren abgeschlossen. Nach einer Anwaltsstatistik ist die Partei dreißigmal gegen die Beobachtung der Bundes-AfD, ihrer Teilorganisation und ihrer Landesverbände durch den Verfassungsschutz gerichtlich vorgegangen. Über ein Dutzend Mal hat die Rechtsaußenpartei gegen Ausgrenzungen im Bundestag und in den Landtagen geklagt. In der Geschichte der Bundesrepublik hat noch nie eine Minderheitspartei so viele Klagen als politische Kampfinstrumente gezielt eingesetzt wie die AfD.
Es gibt auch andere Organisationen, die politische Ziele einklagen. Zum Beispiel zivilgesellschaftliche Nichtregierungsorganisationen. Gerade die „Prozess-NGOs“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, politische Überzeugungen einzuklagen. Das passiert ganz strategisch, sie lancieren teilweise über 100 Klagen.
Natürlich kann jeder klagen, Parteien wie NGOs. Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes garantiert den Rechtsweg für alle. Diesen Schutz will ich nicht antasten. Eine Partei ist aber keine NGO. Ich finde, dass eine Partei auch eine gewisse Verantwortung im Umgang mit rechtsstaatlichen Ressourcen wie der Justiz hat. Ich sehe das als Gemeinwohlverpflichtung. Die geringen Erfolgsquoten der AfD-Klagen beim Bundesverfassungsgericht mit 21 Prozent und bei den Landesverfassungsgerichten mit 16 Prozent sind Indizien dafür, dass die Partei die rechtlichen Erfolgsaussichten von Klagen häufig nicht sorgfältig abwägt. Die geringe rechtliche Substanz etlicher Schriftsätze spiegelt sich zum Beispiel in negativen Verdikten des Bundesverfassungsgerichts über AfD-Klagen wider wie „unzulässig“, „unbegründet“ oder kurz „abgelehnt“. Häufig treffen wir bei den Klagen auf ein Missverhältnis zwischen rechtlicher Substanz und politischen Zielen. Unnötig belastet wird die Justiz auch durch das Einklagen von Bagatellen, zum Beispiel, wenn AfD-Landtagsabgeordnete gegen ihren von der Familie gewünschten Ausschluss vom Staatsbegräbnis eines Ministers klagen. Durch die zahlreichen aussichtlosen Klagen der Rechtspopulisten verlängert sich die Verfahrensdauer aller bei den jeweiligen Gerichten anhängigen Verfahren zulasten der gesamten Rechtsgemeinschaft. Diese negativen Folgen für die Arbeitsfähigkeit der Justiz sind der AfD anscheinend egal.
Sie sagen: Der politische Kampf der Mitte-Parteien gegen die AFD sei weitgehend gescheitert. Warum sind die Erwartungen, die AfD einhegen zu können, an der Realität zerschellt?
Die Parteien der politischen Mitte haben die Bedeutung der illegalen Migration in der Bevölkerung unterschätzt. Grüne, Linkspartei und Teile der SPD tun es heute noch. Die Parteien haben nicht erkannt, dass in allen westlichen multiethnischen Demokratien ein neues Bedürfnis nach nationaler Identität und Souveränität erwacht ist – als Reaktion auf die Globalisierung. Eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürger beobachtet mit anschwellendem Hals, dass es weder der EU noch der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren gelungen ist, die illegale Migration entscheidend zu steuern, zu kontrollieren und zu begrenzen. Viele Politiker haben noch nicht begriffen, dass es beim Kampf gegen die illegale Migration nicht nur Arbeitsplätze, Bürgergeld, Wohnungsnot, sinkende Leistungen in Schulen durch heterogene Schülerschaften und Kriminalität im Kontext von Zuwanderung geht.
Worum dann?
Für große Teile der Bevölkerung geht hier um ihre kulturelle Identität, die sie durch fremde Kulturen und Religionen wie den Islam gefährdet sehen. Diese Dimension haben die Mitteparteien in ihrer Tragweite bisher nicht erkannt – im Gegensatz zur AfD, die diesen Aspekt in das Zentrum ihrer Programmatik und Propaganda gerückt hat. Der Kampf gegen die illegale Migration ist auch Kulturkampf.
In einem Strategiepapier hatte die AfD ja unlängst selbst von einem „Kulturkampf“ gesprochen, der das Ziel hätte, die „Brandmauer“ zu stürzen, um eine Zusammenarbeit von Union und SPD unmöglich zu machen. Wie aber sollten die demokratischen Parteien mit der AfD weiter umgehen? In Ihrem Buch erwähnen Sie dazu eine launige Anekdote. Der Bundestag unterhält, was viele nicht wissen, ein eigenes Fussballteam, den FC Bundestag. Als im Frühjahr ein paar AfD-Abgeordnete mitspielen wollten, sperrten sich die anderen Team-Mitglieder gegen eine Aufnahme von Mitspielern der AfD ins Team. Die AfD klagte wieder, diesmal mit Erfolg: das Landgericht Berlin bestätigte, dass der FC Bundestag AfD-Abgeordnete nicht ausschließen darf. Das ist gewissermaßen das Sinnbild der Frage: Isolieren oder als normale Partei anerkennen?
In so krassen Alternativen würde ich nicht denken. Der richtige Umgang mit der AfD ist eine heikle Frage. Es wäre sicherlich völlig falsch, die AfD wie eine normale Partei zu behandeln. Das zeigt schon die Tatsache, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bundes-AfD als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Auf der anderen Seite muss man sich vor Augen führen, dass die Ausgrenzungspolitik der Mitteparteien auch nicht funktioniert hat – wie steigende Mitgliederzahlen, verstörende Wahlerfolge und Umfragen zeigen. In einem föderalen System wie dem unsrigen ist Ausgrenzung ohnehin schwer durchzuhalten, wenn Sie sehen, dass sie in einigen Bundesländern wie z.B. Sachsen geräuschlos nicht praktiziert wird – da sind ja AfD-Leute Ausschussvorsitzende und Vizepräsidenten im Landtag. Die demokratischen Parteien müssen realisieren, dass die AfD im Bund wie in den Ländern stärkste Oppositionspartei ist.
Ihre Stresstest-Analyse in Sachen AfD mündet in den Hinweis, dass politisch drängender als die Bekämpfung der AfD eigentlich die Aufgabe sei, die Probleme der irregulären Migration politisch in den Griff zu bekommen.
Ja, ich denke, dass das tatsächlich die drängendste Frage ist. Obwohl die Zahl der Asylbewerber im ersten Halbjahr 2025 erheblich gesunken ist, ist damit das Problem der illegalen Migration nicht bewältigt. In den Jahren 2023 und 2024 haben über 500 000 Asylbewerber in Deutschland Schutz gesucht – in beiden Jahren die höchsten Quoten seit der Masseneinwanderung 2015/2016.
Das Problem der illegalen Migration ist komplex.
Die 13.770 Kilometer lange EU-Außengrenze ist nicht wirksam zu kontrollieren. Ohne Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl können Schutzsuchende an den EU-Außen- und Binnengrenzen nicht zurückgewiesen werden – was zu massenhaftem Missbrauch des Asylrechts durch Wirtschaftsflüchtlinge einlädt. Europas Asylrecht hat einen weiten Schutzraum geschaffen, EU-Kommission und EU-Mitgliedsländer tun aber alles, um dieses Asylrecht nicht anzuwenden. Ohne Aufhebung des individuellen Rechts auf Asyl entsteht ein Paradoxon, denn etliche EU-Länder verstoßen in jüngster Zeit immer häufiger gegen das Rückgrat des Rechtsstaats: gegen die Bindung an Gesetz und Recht. Damit untergraben sie die Autorität des Rechtsstaates.
Was befürchten Sie?
Aufgrund der globalen Flüchtlingsströme, der wachsenden Zahl von Autokratien, Diktaturen, Gottesstaaten, dem Klimawandel und dem Wohlstandesgefälle zwischen den EU-Ländern und etlichen asiatischen und afrikanischen Ländern wird der Migrationsdruck auf die EU und Deutschland hoch bleiben, wenn nicht sogar weiter steigen. Dass das „Problem der illegalen Migration nicht gelöst“ ist, hat sogar die ehemalige Kanzlerin Merkel bei der Präsentation ihrer Biographie eingeräumt. Ich hoffe darauf, dass die Debatte dazu offener, ehrlicher und stärker im europäischen Kontext, auf den es letztlich ankommt, geführt wird als es bislang der Fall war.