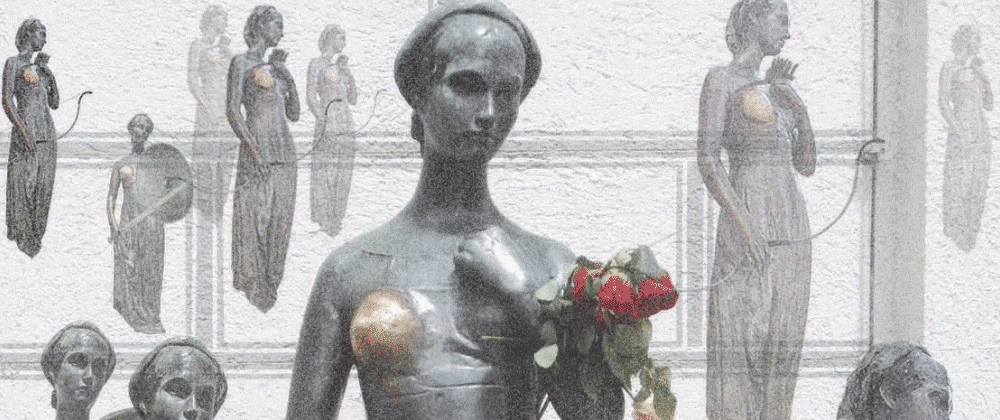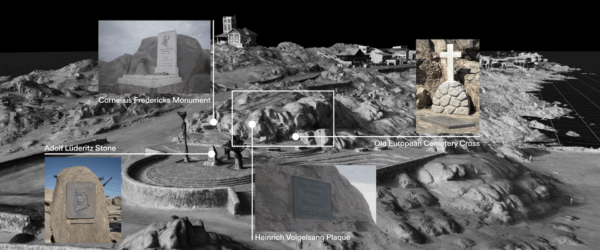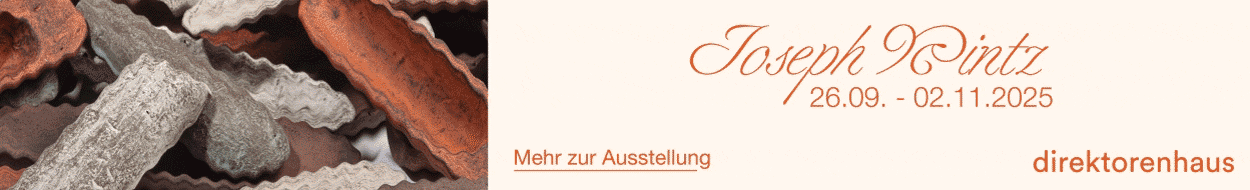Felix Fuhg, Programmleiter eCommemoration der Körber-Stiftung, wagt sich mit seinem „Immersive History Lab“ schon einmal vor.
Herr Fuhg, eine Schulklasse geht in eine Anne-Frank-Ausstellung. Was passiert?
Der eine Teil der Schülerinnen und Schüler wird ohne Erkenntnisse wieder rauslaufen, der andere folgt mit Neugier der Fluchtgeschichte von Anne Frank. Und dann sind da ja noch die Jugendlichen, die selbst Fluchterfahrungen haben…
Wie sehen Flüchtlingskinder eine solche Ausstellung?
Wenn sich Menschen, die aufgrund von Kriegen oder anderen Bedrohungen der Lebensgrundlagen ihr Zuhause verlassen mussten und in Folge dessen die Traumata von Flucht selbst erlebt haben, Gedenkstätten besuchen, setzen sie sich mit der Geschichte – wie etwa der von Anne Frank – auf Grundlage eigener Erlebnisse in Beziehung. Allerdings anders, als wir denken. Es gibt Studien, die untersucht haben, wie Menschen mit Fluchterfahrungen aus Syrien in Gedenkstättenkontexten Fluchtgeschichten von Jüdinnen und Juden wahrnehmen und Empathie für Menschen entwickeln, die aufgrund ihres jüdischen Backgrounds einer Gruppe von Menschen zugerechnet werden, mit denen seit Jahrzehnten kriegerische Auseinandersetzungen geführt werden. Einstudierte Freund-Feind-Schemata geraten dadurch ins Wanken. Zu Beginn der großen Fluchtbewegungen aus Syrien 2015 wurden Formen einer solchen Inbezugsetzung oft als despektierlich empfunden, weil sie die Einzigartigkeit der Fluchtgeschichten aus der NS-Zeit im Kontext der Singularität des Holocausts relativieren würden.
Wie gehen Gedenkstätten damit um?
Viele der erinnerungskulturellen Institutionen haben eine sehr starke Bindung an die Opfer und die Opferverbände, die die Opfergruppen des NS repräsentieren und die auf einem sehr steinigen Weg in der Nachkriegszeit sich ihren Platz in der Gesellschaft erkämpfen mussten. Wir alle können froh sein, dass sie damit erfolgreicher waren als gerade konservative Kräfte es sich gewünscht hatten. Neben ihrem Auftrag, die Geschichte der Opfer zu bewahren, ist es ihre Aufgabe, Brücken aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu schlagen und Bildungsarbeit zu leisten. Und diese Bildungsarbeit geschieht in einer Gesellschaft, die sich vor allem auch durch den Zuzug von Menschen stetig verändert. Das ist ein Spagat, weil beide Welten für einige Akteure nicht immer zueinanderzupassen scheinen.
Neu ist sicherlich die Heterogenität der Besuchergruppen…
Ja, Vielfalt durchaus nicht im negativen Sinne. Wir sagen ja immer: junge Menschen stecken in einer Zeit, in der sie Halt suchen und Klarheit wollen, zugleich Grauzonen und Vielstimmigkeit nicht aushalten, weil sie eh schon von der Welt überfordert sind. Das ist gar nicht mein Eindruck. Mein Eindruck ist eher, dass die Vielstimmigkeit als positiv erkannt wird. Und dass sie gerade in einer Welt, in der Menschen Subidentitäten haben, Halt und Möglichkeiten einer Inbeziehungsetzung schafft. Vielstimmigkeit ermöglicht in einer zunehmend fragmentierten Welt, über die ja gerade Soziologinnen und Soziologen seit vielen Jahren schreiben, sich wiederzuerkennen. Geschichte wurde von Kindern, Männern und Frauen, von Opfern und von Tätern völlig unterschiedlich erlebt. Dies gilt natürlich auch für Kriegserfahrungen von Menschen verschiedener Klassenzugehörigkeiten.
Es gibt nicht die eine Sichtweise.
Wann endete der Zweite Weltkrieg? Seit dem Aufkommen der Alltagsgeschichte gab es genau darüber Diskussionen. Klar, die Mehrheit sagt: am 8. Mai 1945 mit der Unterzeichnung der Kapitulationserklärung durch Wilhelm Keitel in Karlshorst. Andere wieder sagen, wie z.B. der Historiker Michael Wildt, dass der Zweite Weltkrieg für viele Menschen erst mit der Währungsreform zu Ende ging, weil sich ab da im Alltag der Menschen etwas änderte. Was ich sagen will: diese Vielfältigkeit – die mentalitätsgeschichtliche Perspektive, die ereignisgeschichtliche Perspektive, eine politikgeschichtliche Perspektive – alles das hat seine Berechtigung. Man kann diese Perspektiven nebeneinanderstehen lassen.
In „tausend Welten“.
Die tausend Welten, die man einfach auch akzeptieren muss. Wir leben im Zeitalter des Internets. Menschen können sich aus dem Netz rauspicken, was sie möchten. Eine neue Informationsfreiheit, die eingebettet ist in die Macht der Algorithmen, die aber dafür sorgt, dass die Kontrolle über das, womit und worüber sich Menschen informieren, von den traditionellen Medienorganen in die neuen, oft unklaren und uneinsichtigen Weiten des Internets übergeht; eine Realität, die eben Teil einer von Informationsfreiheit geprägten Demokratie ist. Für einige schreit genau das nach einer Rückkehr zu einem analogen linearen Bildungsauftrag, um ein Gegengewicht zu schaffen. Ich würde im Kontext der historisch-politischen Bildungsarbeit eher dafür plädieren, diese neue Realität zu studieren und Angebote zu schaffen, die sich auf diese Realität beziehen, damit sich junge Menschen mit der Vergangenheit auseinandersetzen.
Sind neue Technologien nun das Allheilmittel, mit denen man Jugendliche zur Auseinandersetzung mit Geschichte bewegen kann?
Es hängt sicherlich nicht von der Technologie als solcher ab, sondern davon, auf welche Weise sie in einem Erinnerungsprojekt verwendet wird. Grundsätzlich halte ich viel von digitalen Technologien, zumal sich unsere Bildwelten in den letzten Jahren so unfassbar verändert haben. Die neuen digitalen Bildwelten eröffnen neue Zugänge zu Fantasien. Fantasieren und Geschichtsschreibung haben ein langes konfliktgeladenes Verhältnis, denn seit der Entstehung der akademischen Geschichtswissenschaft wurde das Fiktive und das Fabulieren stets als unvereinbar mit dem Erzählen von Geschichte angesehen. Dabei lassen uns die Leerstellen in Archiven und die, die aus den Mustern einstudierter Sammlungspraktiken resultieren, oft keine andere Wahl.
In Bezug auf die Gedenkkultur kommt man aber schnell an kritische Punkte. KI-Tools z.B. können alte Fotos animieren, zum Leben erwecken. Würde man das mit dem Foto eines KZ-Häftlings machen wollen?
Sehr schwierige Frage – und ich kann sie noch nicht einmal sofort verneinen. Die Frage von dem, was wissenschaftlich ist, und von dem, was als ethisch vertretbar gilt, haben Gesellschaften immer wieder aufs Neue ausgehandelt. Die Frage ist ja: gilt etwas als historisch objektiv, nur weil wir eine Situation heute fotografisch-dokumentarisch überliefert haben? Ist es nicht weiterhin die Interpretation des Bildes, das uns am Ende Aufschlüsse liefert, nicht die Pixel an und für sich? Was passierte in KZs? Das Leben in den KZs wurde kaum fotografisch dokumentiert. Es gibt fotografische Dokumente, mit denen wir uns die damaligen Situationen erschließen können, gerade nach der Ankunft der Alliierten nach 1945, diese Schreckensbilder, die wir alle kennen. Aber viele Erzählungen sind nur in den Gedanken der Überlebenden überliefert. Eine israelische Stiftung hat einmal diese Erzählungen aufgenommen und über einen Text-to-Image-Bildgenerator in eine visuelle Projektion umgearbeitet. Die Aufregung war groß. Aber wo, kann man sich fragen, war der Unterschied zwischen den Bildern, die nach Zeitzeugenberichten in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer entstehen und der visuellen Widergabe der KI? Auch wir malen uns Bilder im Kopf, die nicht objektiv „überprüfbar“ sind.
Im Comic passiert ähnliches.
Genau, und auch in der Illustration. Irgendwann verlassen Autorinnen und Autoren den Pfad der – von der französischen Philosophie der Moderne so sehr kritisierten – „Wahrheit“ und begeben sich ins Reich der Fiktion. Ob im Kopf, im historischen Roman oder in der KI – wir dichten hinzu, und da ist es noch nicht einmal entscheidend, ob der Autor ein Mensch oder eine KI ist. Ich selbst habe als Wissenschaftler, auch wenn Plausibilität und die Sichtbarmachung des interpretativen Moments zentral waren, genau das immer wieder getan: Erzählungen zusammengeführt und in Beziehung gesetzt in Form eines von mir als Wissenschaftler initiierten kreativen Schaffensprozess, um Sinn aus Überliefertem zu stiften. Anders lässt sich Geschichte überhaupt nicht schreiben. Auch Klio dichtet und hat immer auch Prosa als Referenz, argumentierte der einflussreiche amerikanische Historiker Hayden White.
Ist Geschichtswissenschaft eine Wissenschaft? Oder nicht doch vielleicht – auch wenn es niemand zugeben will – eine Form von Kunst?
Das ist die große Frage, auch bei uns in der Körber-Stiftung. Mir begegnet diese Frage sehr oft. Da gibt es die einen, die sich der Truth Production verpflichtet fühlen – im Sinne des naturwissenschaftlichen Positivismus nach Popper. Dann gibt es aber auch Leute wie mich, die immer wieder darauf verweisen, dass sie als Historikerinnen und Historiker einen Bachelor und/oder Master of Arts erworben haben, und feststellen, dass sie doch nicht so ein Truth Producer sind, der, wie in einem chemischen Experiment, für sich beansprucht, einen Logos zu finden. Wir erzählen Geschichten, wir puzzlen, wir schauen aus der Gegenwart in die Vergangenheit und glauben, durch das Studieren des Überlieferten mit den Toten zu sprechen. Für mich waren das Sinnkrisen meines Historikerdaseins, da sich Fragen über die eigene Praxis des Erforschens, Schreibens, und Vermittelns von Geschichte ergeben haben, die sich bis heute auch in weiten Teilen nicht lösen lassen konnten. Kunst war meine Rettung, denn sie gab mir die Chance, mit diesen Problemen nicht nur leben zu können, sondern sie selbst zum Gegenstand werden zu lassen.
Darf die Künstliche Intelligenz historische Lücken füllen?
Saidiya Hartman, eine Literaturwissenschaftlerin, die in New York an der Columbia University tätig ist, verfolgt ein Konzept, das sich Critical Fabulations nennt. Die afro-amerikanische Wissenschaftlerin, die auch Schriftstellerin ist, verwendete in ihrem 2007 erschienenen Buch Lose Your Mother diese Methode. Sie versuchte damit, die ungeschriebene Geschichte der Erfahrung versklavter Menschen darzustellen und ihre Schicksale auf diese Weise vor der Vergessenheit zu retten. Um auf das Beispiel der Konzentrationslager zurückzukommen: Von den KZ-Häftlingen haben manche überlebt, die meisten aber eben nicht. Gerade von denen, die nicht überlebten, haben wir nur wenige bis keine Überlieferungen. Was jetzt Saidiya Hartman vielleicht sagen würde, wäre: so wie es schwer ist, über queeres schwarzes Leben im New York der zwanziger Jahre auf klassischer Faktenbasis zu schreiben, weil dazu eine lineare Quellenbasis fehlt, so sind auch zahlreiche Aspekte der NS-Geschichtsschreibung unbeleuchtet. Hartman würde sich das Wissen aus unterschiedlichen Beständen aneignen, daraus ihre Synthese kreieren und auch fiktive Charaktere entstehen lassen. Sie fabuliert kritisch auf Grundlage von überliefertem Wissen. Diese Grenzerfahrungen zwischen Fakt und Fiktion begegnen uns natürlich auch in diesen digitalen Formaten sehr oft.
Wer mal Battlefield gespielt hat, kann das nachvollziehen.
Das ist doch spannend. Ich habe einmal mit Spieleentwicklern gesprochen. Es ist nicht so, dass die Szenarien in vielen Computerspielen, die sich mit historischen Kriegen auseinandersetzen, alle fiktional sind. Allein aufgrund zur Verkürzung von Produktionszeiten greifen Entwickler gern auf Quellenmaterial zurück, um möglichst effizient Schlachtfeldszenarios entstehen zu lassen. Warum sich selbst Gedanken machen, wenn es bereits Inspirationen gibt, die sich nutzen lassen?
Das Computerspiel Anno 1800 hat bei historischen Simulationsspielen Maßstäbe gesetzt. Anno 1800 spielt in der Zeit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts, man kann ein fiktives Inselreich aufbauen und es durch Investitionsentscheidungen und kluge politische Steuerung in eine nächsthöhere Zivilisationsstufe bringen. Kritiker werfen dem Spiel vor, dass es die Sklaventhematik ausblenden würde, was Folgen für das Geschichtsbild der vielen Nutzer hätte. Angesichts der extremen Reichweite, die diese Spiele erreichen, ist das nicht von der Hand zu weisen.
Aus diesem Grund sollten sich alle, die sich mit professionell mit Erinnerungskultur und Geschichtsvermittlung befassen, mit digitalen Welten beschäftigen. Anno 1800 hat um die 2,5 Millionen Spielerinnen und Spieler, man muss davon ausgehen, dass digitale Spiele einen Einfluss auf Geschichtsbilder der heutigen jungen Generation haben. Ob wir es wollen oder nicht, diese Angebote sind da, sie sind populär und prägen die Verständniswelt der Jugendlichen. Aber es ist natürlich richtig, dass die Darstellung von Geschichte in popkulturellen Medienformaten wie Blockbuster-Games Probleme wie die Reproduktion von bekannten, zum Teil auch irreführenden, Entwicklungen ausblendenden Geschichtsdeutungen mit sich bringt. Bei Anno 1800 ist das offensichtlich. Dies liegt unter anderem auch daran, dass die Entwicklung von Blockbuster Games kapitalistischen Logiken folgt. Das Spiel soll in erster Linie gut verkaufbar sein. Und um Spielerinnen und Spieler nicht abzuschrecken, holt man sie mit Geschichtsnarrativen dort ab, wo sie stehen. Beim düsteren Mittelalter, das geprägt von roher Gewalt und Männlichkeit war, obwohl jüngere Forschungen ein ganz anderes Bild von der Zeit zeigen. Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich immer wieder. Erst im letzten Jahr gab es eine Kontroverse rund um den Release des Spiels Assassin’s Creed Shadows. Es spielt im Japan des 16. Jahrhunderts. Im Zentrum steht der Character Yasuke, ein schwarzer Samurai, den es nach Einschätzung von Forschenden durchaus gegeben haben könnte in der Zeit. Fans der Reihe waren irritiert und brachten ihren Unmut zum Ausdruck, weil sie hinter der Darstellung von Yasuke reine politische Absichten von Ubisoft sahen.
Digitale Technologien dienen aber nicht nur dem Entertainment.
Nein, digitale Technologien werden in der Geschichtswissenschaft auf der einen Seite stark genutzt, um Fragen von Konservierung und von Erhalt zu lösen, also die Frage von Rekonstruktion und Sicherstellung dessen, was überliefert ist. Historikerinnen und Historiker nutzen heute auch digitale Tools für die Auswertung von Quellen. Gleichzeitig können sie auch spekulativen Ansätzen Tür und Tor öffnen. Diese „What-if“-Narrative sind in der Geschichtsschreibung nicht neu.
Was wäre, wenn die britische Luftwaffe die Schienen zu den KZ bombardiert hätte?
Genau. Es gibt immer diese Sehnsucht, die sogenannten Scheidewege der Geschichte unter die Lupe zu nehmen. Was wäre gewesen? Selbst die großen Geschichtswissenschaftler des 20. Jahrhunderts haben sich damit beschäftigt, Hans-Ulrich Wehler etwa, der den Sammelband „Scheidewege der deutschen Geschichte“ herausgegeben hat, wo unter anderem der Frage nachgegangen wurde: Was wäre gewesen, wenn Franz Ferdinand nicht erschossen worden wäre? Wäre es dann zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs gekommen? Simulationen des Vergangenen bedienen diese Sehnsüchte. Man darf nicht vergessen: die Ursprünge von Computerspielen lagen eigentlich in Wirtschaftssimulationen bzw. im Durchspielen von Kriegsszenarien im militärischen Kontext. Was passiert, wenn Rakete X auf Gebiet Y abgeschossen wird? Vorwärts gerichtete Spekulation und rückwärts gewandte Alternativgeschichte sind wesensverwandt und passen gut zueinander. Ich finde, dass man heute den Raum für spekulatives Geschichtserzählen öffnen sollte.
Was ist das Immersive History Lab, das mit der Körber-Stiftung aufgebaut wurde?
Das neue Immersive History Lab der Körber-Stiftung, das ich im Rahmen des eCommemoration-Programms initiiert habe, beschäftigt sich mit neuen Strategien des Geschichtserzählens. Es unterstützt Künstlerinnen und Künstler, die immersive digitale Strategien nutzen, neue Wege zu finden, Menschen mit der Vergangenheit in Kontakt zu bringen. Zeitgenössische Künste können Antworten auf eine zunehmende Geschichtsverdrossenheit finden. Im Lab arbeiten wir gerade mit dem Opernmacher Michael von zur Mühlen zusammen, mit dem wir eine Installation entwickeln. Bei ihrem Besuch werden sich Besucherinnen und Besucher als temporäres Kollektiv einer großen Projektion gegenüberstellen, auf der sich eine Vielzahl von digitalen Avataren befinden werden, die als Chatbots agieren und deren Wissen sich aus dem Wissensbeständen der Archive sozialer Bewegungen speist. Im Raum interagiert das Kollektiv mit den Chatbots. Der Besuch der Installation wird zur Gemeinschaftserfahrung, es entstehen Situationen der Abstimmung, bei denen sich Besucherinnen und Besucher vor Ort austauschen müssen: Wer geht ans Mikro? Was fragen wir? Wir möchten Möglichkeitsräume schaffen, in denen die Menschen mit Fragen nach Hause gehen und sie hoffentlich gemeinschaftlich mit anderen diskutieren und beantworten.
Wo sollen derartige Installationen gezeigt werden?
Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die klassische Trennung von Kunstwelt und Sachmuseum hinter uns zu lassen. Diese Trennung existiert ja: Auf der einen Seite haben wir die sachorientierten Museen, in denen mit Ausstellungstexten Vermittlung- und Bildungsarbeit im klassischen Sinne stattfindet. Dann haben wir das White Cube Setting, in dem zeitgenössische Kunst ohne große Interpretationshilfe präsentiert wird. Darüber hinaus gibt es noch performative Häuser, Theaterhäuser, freie Häuser, Staatstheater, Kulturfabriken. Mit unseren Formaten möchten wir die Spartentrennungen aufbrechen. Es ist geplant, die Installation an Orten wie dem Focke-Museum in Bremen zu zeigen, genauso wie am Staatstheater Nürnberg. Oder sie geht mit dem Goethe-Institut auf Reisen.
Unter dem neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer könnten manche Pläne ins Stocken geraten…
Ja, gut möglich… ich sehe da tatsächlich einen drohenden Rückschritt. Weimers selbsternanntes Ziel ist es ja, dass von Claudia Roth angeschobene Ausweitung des Gedenkstättenkonzeptes auf Fragen der Kolonialverbrechen ad acta zu legen. Sein Argument: eine Erweiterung des Gedenkstättenkonzepts würde die Singularität des Holocausts verwischen. Dabei wird schon seit Jahrzehnten in den Geschichtswissenschaften, in den Literatur- und Kulturwissenschaften, vor allem aber auch in den vor allem im angelsächsischen Raum verbreiteten Genocide Studies immer wieder auch durch diachrone und regional vergleichende Perspektiven um die Deutung des Allgemeinen und Partikularen im Kontext von Völkermorden gerungen. Weimer möchte zurückkehren zu einer in der deutschen Erinnerungskultur einstudierten Klarheit. Wie vorhin beschrieben sehe ich die nicht. Ich denke, die meisten anderen Gedenkstättenleiterinnen und -leiter zerreiben sich diesbezüglich gerade; es geht ihnen ja nicht um Gleichsetzung, sondern um die Frage von Bezügen, die letzten Endes immer wieder im Prozess der Forschung auftauchen und Sinn machen.
Warum sollte sich die Gedenkkultur derart öffnen?
Ich kann dazu ein Buch erwähnen, das mich geprägt hat: „Multidirectional Memory, Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization“ von Michael Rothberg, der an der UCLA in Kalifornien lehrt. Rothberg zeichnet eine intellektuelle erinnerungskulturelle Tradition im 20. Jahrhundert nach, die von wechselseitigen Bezugnahmen zwischen Kolonialismus, Sklaverei, Rassismus und Nationalsozialismus, Holocaust, Antisemitismus gekennzeichnet ist. Dieses Archiv der multidirektionalen Erinnerung, das Hannah Arendt, Aimé Césaire, W.E.B. Du Bois, Marguerite Duras, Michael Haneke und andere versammelt, deutet er so: es muss doch gehen, dass sich Opferkonkurrenz und Aufmerksamkeitskonflikte auf dem Feld der Erinnerung vermeiden lassen. Stattdessen sollten lieber Analogiebildungen, Querverweise und Vergleiche in den Fokus rücken. Es geht ihm also gerade nicht um Verwischung, sondern um Stärkung der Erinnerung, ohne die Spezifik der jeweiligen Gewaltgeschichten und Herrschaftsverhältnisse infrage zu stellen.
Da wären wir wieder am Anfang: Fluchterfahrungen, an die sich ein syrisch-stämmiger Besucher erinnert, wenn er in der Anne-Frank-Ausstellung steht, bleiben individuell und sollten nicht gegen historische Leiden anderer ausgespielt werden.
Michael Rothberg nennt das das sogenannte „Zero Sum Game“. Was ist mehr? Was ist schlimmer? Besser, als die Communities gegeneinander auszuspielen wäre es doch, Akte der Solidarität zu wecken. Wenn man die „deutsche Singularität“ festschreiben will, wie es Weimer tut, dann schafft man sich sein eigenes Gefängnis. Man kommt dann aus diesem Narrativ nicht mehr heraus.