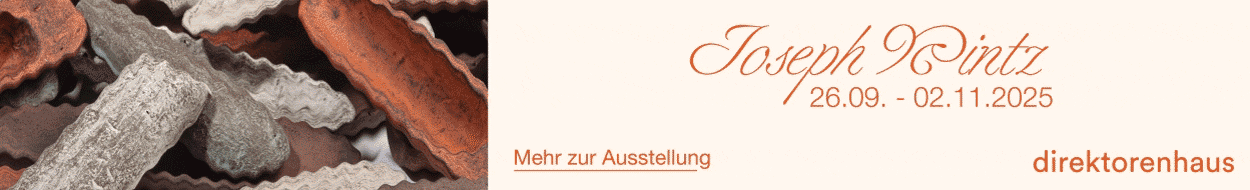Paul Eluard wusste es. Die Welt ist ein Knoten von Konflikten, und in den Augen eines beschlagenen Menschen kann die politische Komplexität den Rahmen des Nachvollziehbaren schon überschreiten. Oder verstehen Sie genau, was überall passiert? Wir erleben dieser Tage das Schauspiel einer sich rasant abbauenden demokratischen Grundordnung in den USA. Dieser Umbau des Staatsapparates erfolgt mit einer frappierenden Offenheit: Es gibt mit „Project 2025“ einen nachlesbaren Action-Plan für diesen Umbau, und wenn Trump eine Verschiebung von Freiheitsrechten verkündet, dann erfolgt dies mit der ihm eigenen Eleganz, wenn er im Oval Office ein Dekret in die Kameras der Weltpresse hält und man weiss: nun dürfen Transgender-Personen nicht mehr zum Militär, die Entwicklungshilfe wird ausgesetzt, Migranten aus Venezuela werden ohne reguläres Verfahren ausgeflogen. Ungarische Verhältnisse? Die Nachvollziehbarkeit von Politik und Verwaltung sowie…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.