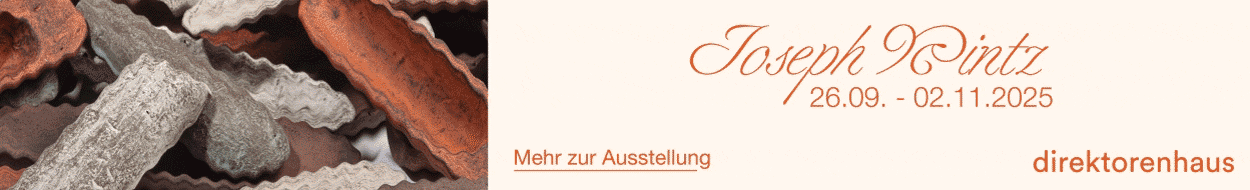Unsere Phantasie ist ein Triumphbogen. Das ganze Leben zieht durch ihn hindurch. Das Leben des heutigen Wandels und Handels, der Satelliten und Mobilfunknetze, das Leben mit seinen Sitten und Eigenarten. In Deutschland hat man eine besondere Spielart der Phantasie perfektioniert, die man „angewandte Phantasie“ nennen könnte. Deutschland ist das Land der metaphysischen Ingenieure. Hier werden keine globalen Geschäftsmodelle entwickelt, der Deutsche denkt in greifbaren Produkten. Auf der einen Parzelle werden Spielzeugeisenbahnen gefertigt, auf dem Nachbargrundstück Windkrafträder. Man hat für jede Frage des Lebens eine Antwort in Form eines Produktes. Das ist die klassische Erzählung der deutschen Nachkriegswirtschaftsgeschichte – bis vor kurzem. Die Prosperität der deutschen Wirtschaft wurde auf die Stärke von Industrie und Export zurückgeführt. Es war die (alte) Industrie, die überraschenderweise auch noch in Zeiten globaler Umbrüche lange Zeit…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.