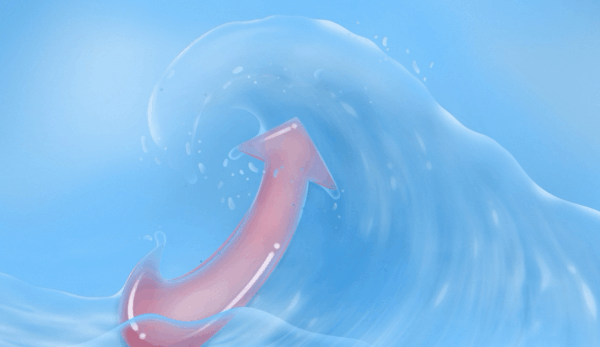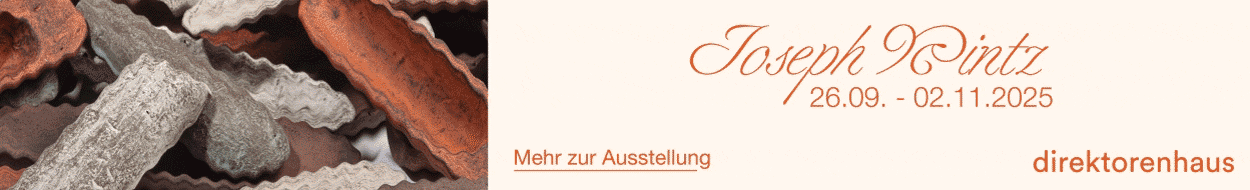Ab und zu stößt man noch auf sie: kleinere Kioske, Buden oder „Trinkhallen“. Das Phänomen Trinkhalle wurde sogar unlängst zum Immateriellen Kulturgut erklärt. Entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung dienten die Trinkhallen in Deutschland ursprünglich dazu, ausschließlich alkoholfreie Getränke anzubieten. Um die öffentliche Wasserqualität war es schlecht bestellt. Namen gab es viele für diese Kioske: Bude (im Ruhrgebiet), Büdchen (in Düsseldorf, Köln und Wuppertal), Wasserhäuschen (in Frankfurt am Main) oder Budike (in Berlin oder Sachsen). Der historische Kern der Trinkhalle war also das gute Wasser: So wie in Kurorten die große Trinkhalle zentraler Anlaufpunkt für die Aristokratie war, um innerhalb der Kuranlage das frische Heilwasser zu schöpfen, diente die kleine Trinkhalle in Städten zur Nahversorgung der Bevölkerung mit klarem Wasser. Der erste Zeitungskiosk wurde…
Alle Artikel in voller Länge.
Mit Relation Plus.
Vorteile auf einen Blick:
• Erster Monat kostenlos • Danach 16 EUR monatlich oder Abo beenden
• Voller Zugriff auf alle Artikel • Monatlich kündbar
Sie haben bereits Relation Plus abonniert? Hier einloggen.